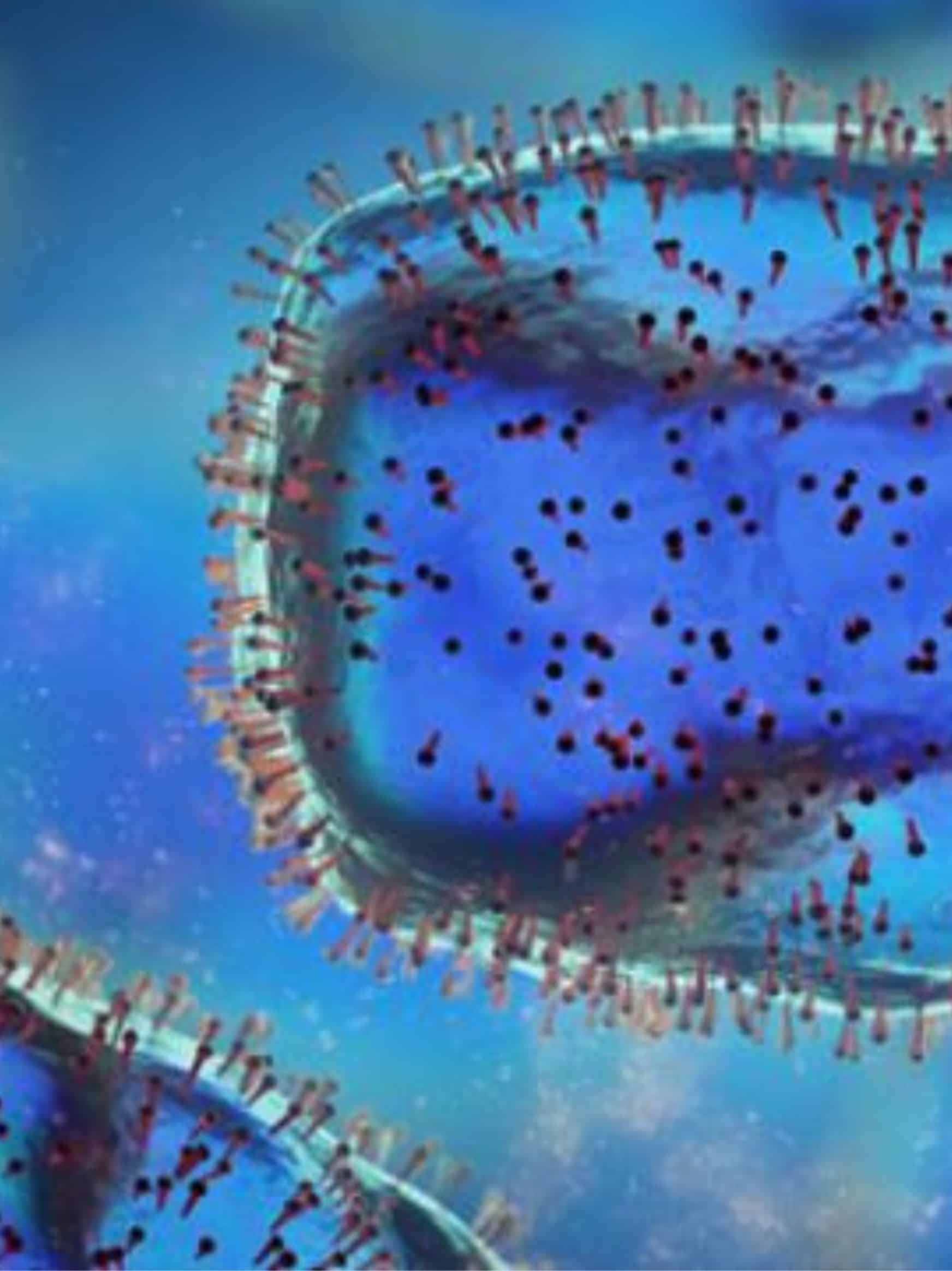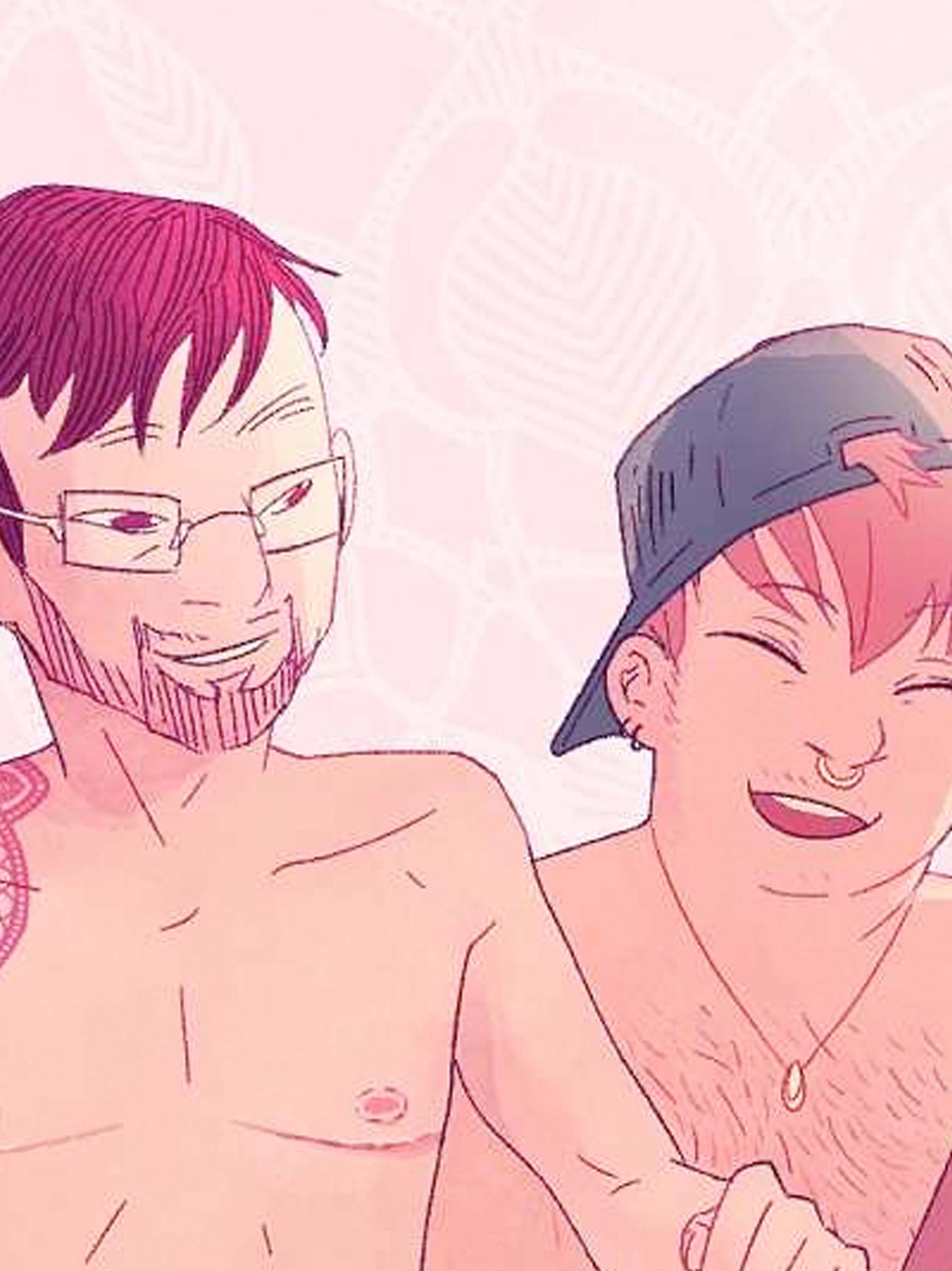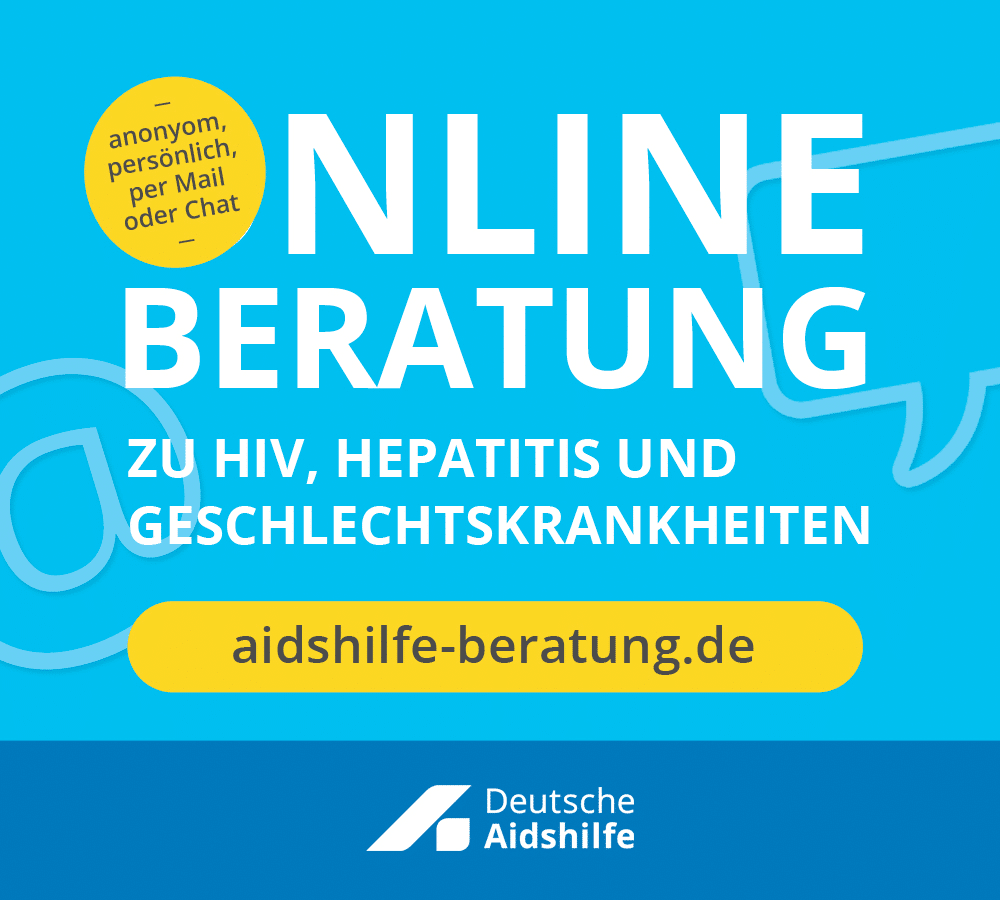„Dann kommt man in die komische Situation, dass man selber die Leute trösten muss.“ Der Bankkaufmann Dirk Stöllger über sein HIV-Coming Out.
Du bist vor 12 Jahren überraschend positiv getestet worden. Wie war das für dich?
Das hat mir erst einmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Horror-Szenarien haben sich zwar nicht vor mir aufgebaut. Schließlich kannte ich ja den Stand der Forschung damals — ich hatte schon vorher einen HIV-positiven Partner gehabt. Aber es ist dann doch etwas anderes, wenn es dich selber trifft. Drei Wochen war ich erst einmal krankgeschrieben.

Du arbeitest seit 28 Jahren als Banker. Wie hast du dich bei der Rückkehr zum Arbeitsplatz verhalten?
Es gab für mich zwei Wege: Entweder meine Infektion verstecken. Oder offensiv damit umgehen. Ich habe mich für Zweiteres entschieden.
Also ein Coming Out vor allen Kollegen?
Genau. Ich habe damals noch nicht in der Zentrale gearbeitet, sondern in einer Filiale. Montagmorgens gibt es da immer die sogenannten „Filialrunden“, wo Geschäftliches, aber auch mal Privates, wie Weihnachtsfeiern oder Ähnliches gemeinsam gesprochen wird. Da habe ich gleich zu Anfang um das Wort gebeten und angekündigt, dass ich für das Amt des Ersthelfers ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehe.
…ein Ersthelfer, derjenige, der im Notfall erste Hilfe leistet, ist in jeder öffentlichen Institutionen vorgeschrieben…
Richtig. Und dann habe ich darum gebeten, dass mein Nachfolger außerdem in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich selbst blutend zusammenbreche, Schutzhandschuhe benutzen sollte. Da sah ich es dann natürlich in den Gesichtern meiner Kollegen rattern.
Das heißt, du musstest gar nicht viel mehr sagen?
Meine Kollegen wussten natürlich, dass ich schwul bin. Ich bin ja keine Klemmschwester! Eine Kollegin fing an zu weinen, stand auf und nahm mich in den Arm. Viel über die Bankgeschäfte wurde dann nicht mehr gesprochen. Überhaupt wurde mehr geheult als gesprochen. Man kommt ja dann in die komische Situation, dass man selber die Leute trösten muss. Gerade Heterosexuelle glauben ja, dass man dann in zwei Jahren tot ist. Das war vor 12 Jahren natürlich noch viel stärker in den Köpfen drin als heute.
Gab es noch weitere Folgen?
Nur dass die Filiale an dem Tag erst später öffnete. Ein Schild informierte die Kunden über eine „technische Störung im Betriebsablauf“. Und damit war das Thema dann durch.
Denkst du, dass diese Erfahrung typisch ist?
Typisch jedenfalls für meine Bank, sprich meinen Arbeitgeber. Generell haben Bankmitarbeiter schon mal ein gewisses Bildungsniveau. Und selbst wenn mich jemand hätte diskriminieren wollen, hätte er sich das in unserem Haus sicher nicht gewagt. Die Regularien der Bank verbieten ausdrücklich jede Diskriminierung. Sowohl gegen Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Gesundheitszustand. Hinterlegt ist das auch mit arbeitsrechtlichen Sanktionen. Wer diskriminiert, hat in unserem Institut nichts zu suchen. Das hat es natürlich für mich einfacher gemacht.
Du arbeitest seit fünf Jahren als einer der fünf freigestellten Berliner Betriebsräte der Firma.
Ja, inzwischen kümmere ich mich selbst ausschließlich ums das Seelenleben unserer Mitarbeiter. Auch meine Wahl hat übrigens gezeigt, dass mir meine Offenheit nicht geschadet hat, sondern bankpolitisch eher genutzt hat. Meine Wähler haben sich dadurch eher vermehrt. 2500 Mitarbeiter haben offensichtlich nichts dagegen, dass ich schwul und HIV-positiv bin.
Bist du in diesen fünf Jahren anderen Fällen von Diskriminierung begegnet?
Das passiert wirklich super selten. Ich erinnere mich an einen Fall einer lesbischen Kollegin, die von ihrem Chef geschnitten wurde und blöde Sprüche über sich ergehen lassen musste. Aber der Arbeitgeber ist in diesen Fällen absolut konsequent. Ohne Wenn und Aber. Der betreffende Kollege arbeite heute nicht mehr bei uns.
Du warst 2010 bei der ersten Kampagne „HIV und Arbeit“ bundesweit auf Plakaten zu sehen. „Mit HIV kann ich leben. Mit Kollegen, die mich diskriminieren, nicht.“ Wie ist es dazu gekommen?
Sie waren auf der Suche nach HIV-Positiven, die nicht unbedingt in Klischeeberufen wie Friseur, Flugbegleiter oder Barmann arbeiten. Dabei sind sie über den Artikel über mich in der FAZ aus dem Vorjahr gestoßen.

Für das Plakat der Kampagne wurde in der Filiale fotografiert. Wie ist das abgelaufen?
Sie wollten auf dem Foto ein reales Arbeitsumfeld und reale Kollegen zeigen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat dafür selbst die Genehmigung aus Frankfurt bekommen. Von meinen damaligen zwölf Kollegen aus der Filiale haben sich tatsächlich elf bereit erklärt, mit aufs Foto zu kommen — zwei wurden nur gebraucht. Mit dieser Resonanz hätte selbst ich nicht gerechnet.
Wie waren die Reaktionen?
Es gab fast ausschließlich Applaus. Ich habe immer gewartet, dass irgendwas passiert. Aber es passierte nichts — außer das ich mit Presseterminen zugeschüttet wurde.
Hat dein damaliger Partner es dir gleichgetan und sich am Arbeitsplatz geoutet?
Nein, er arbeitet in der Baubranche, die ja extrem heterolastig ist. Er war auch ziemlich erschrocken, als ich — nach unserer Trennung übrigens — auf den Plakaten auftauchte. Dass ich sein Ex war, wussten natürlich viele. Auch mein jetziger Partner ist HIV-positiv und ist am Arbeitsplatz ungeoutet: Sein Arbeitgeber ist eine Discounter-Kette, die als extrem arbeitnehmerunfreundlich bekannt ist.
Glaubst du, dass man unter dem Versteckspiel leidet?
Ich denke ja. Allein schon, wenn es um die Rechtfertigung von Arztterminen geht. Es wäre sicher für alle einfacher, wenn man in allen Branchen freizügiger mit dem Thema umgehen könnte.