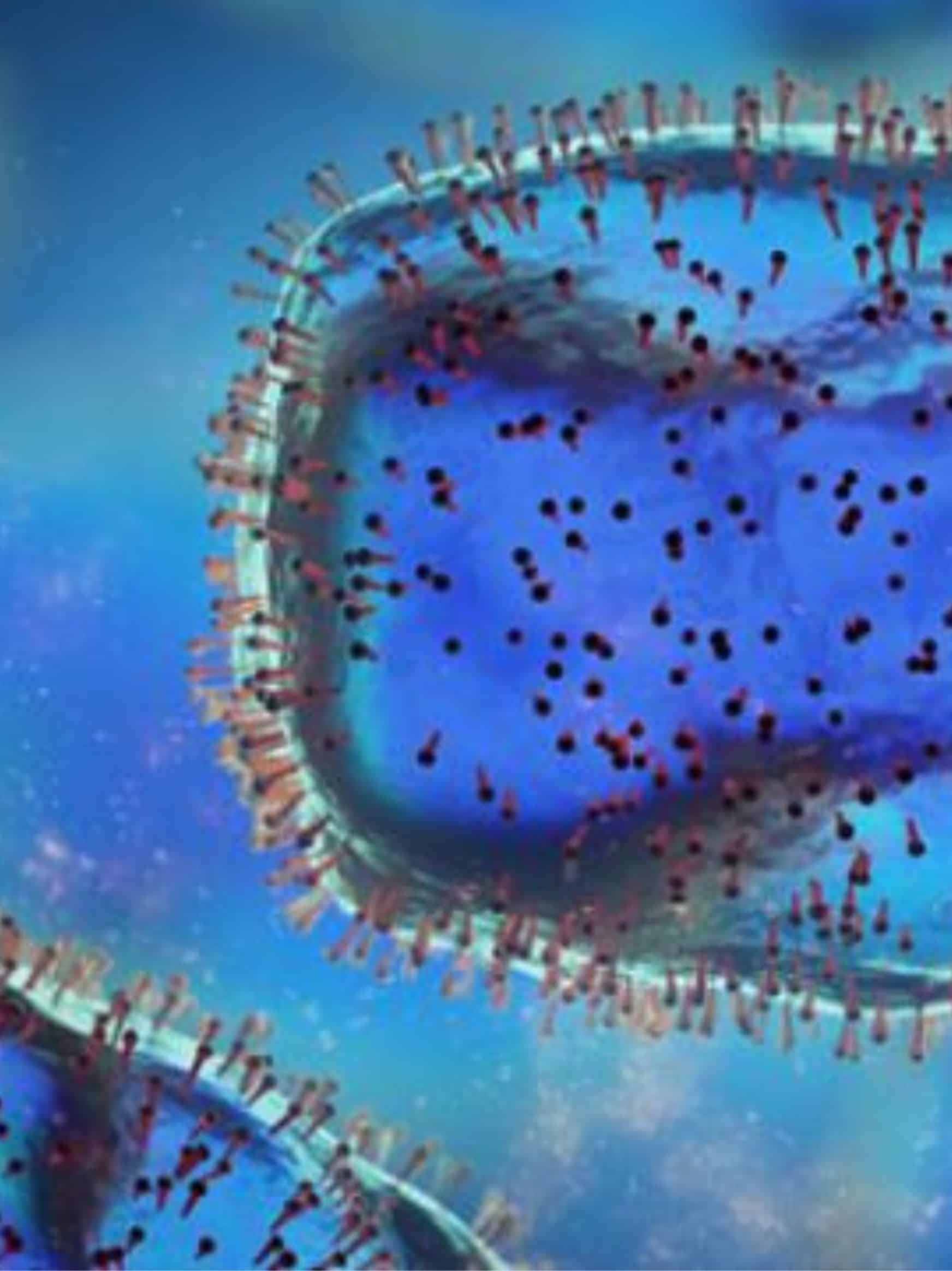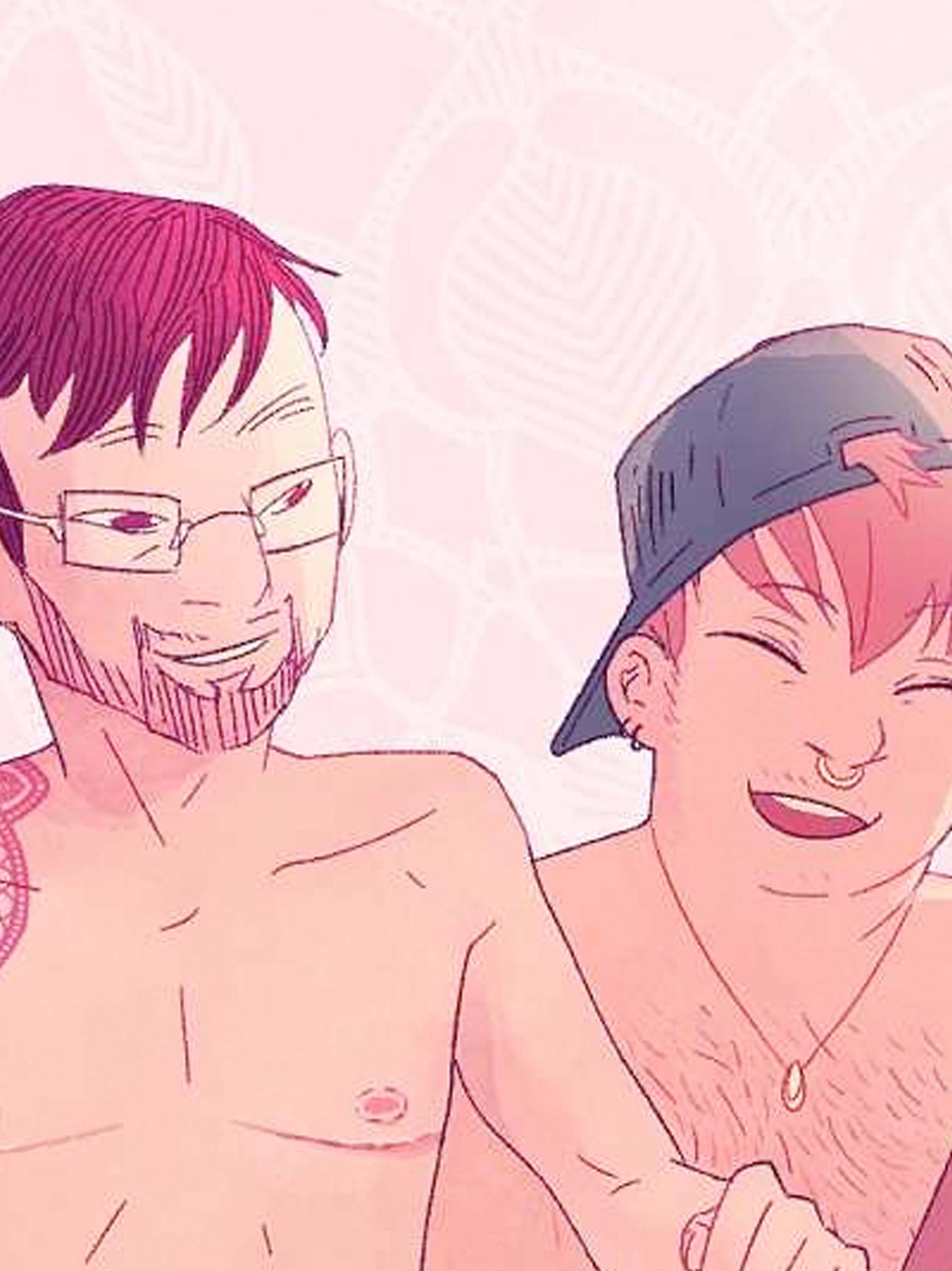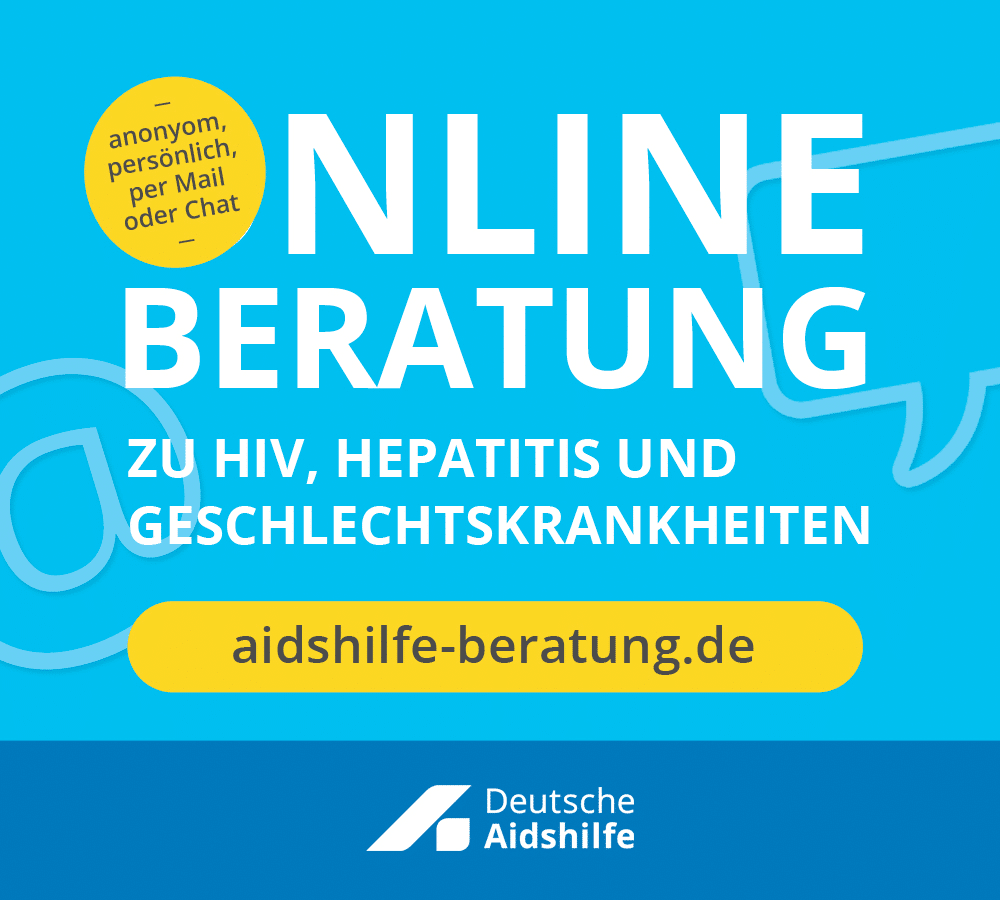Depressionen und Angstzustände kommen bei schwulen und bisexuellen Männern doppelt so häufig vor wie bei heterosexuellen. Eine Ursache sind wahrscheinlich die vielen Diskriminierungserlebnisse, mit denen sie zurechtkommen müssen. Das belastet nicht nur persönlich, sondern torpediert auch die HIV-Prävention. Daten dazu liefern nun die Ergebnisse der Pilotstudie „Wie geht’s Euch?“

Diskriminierung kann schwule Männer depressiv machen. Das belegt eine Pilotstudie, die im Sommer 2012 mit Unterstützung der Deutschen AIDS-Hilfe durchgeführt wurde. Rund 1.600 schwule und bisexuelle Männer zwischen 16 und 77 Jahren beteiligten sich an der Online-Umfrage mit dem Titel „Wie geht´s Euch?“. Die nun vorliegende Auswertung liefert bedrückende Zahlen: Bei einem Drittel (33 Prozent) der Befragten deuten die Aussagen auf erhöhte depressive Symptome hin.
„Diese Werte sind überraschend hoch“, schreiben die Studienautoren Dr. Dirk Sander und Martin Kruspe, schränken allerdings ein: „Die Ergebnisse sind nicht zwangsläufig klinisch relevant, da nicht ermittelt werden kann, wie schwer die angegebenen Symptome wirklich sind.“ Auch seien die Umfragedaten mit äußerster Vorsicht zu interpretieren, da die Erhebung nicht repräsentativ sei. Jedoch lasse sich anhand dieser Zahlen „schon jetzt ein erhöhter Bedarf für präventive Angebote deutlich erkennen“.
Die Hälfte der Befragten berichtete von „Zurückweisung durch Familienmitglieder“
Eine wesentliche Ursache für die beunruhigenden Werte dürften die vielfältigen Diskriminierungen sein, denen schwule und bisexuelle Männer ausgesetzt sind. Die Hälfte der Befragten berichtete von „Zurückweisung durch Familienmitglieder“. Ungefähr zwei Drittel gaben an, antihomosexuelle Beschimpfungen erlebt zu haben. Gewalterfahrungen waren seltener (25 Prozent), diese hatten allerdings den größten Einfluss auf das seelische Wohlbefinden der Teilnehmer.
Die Studie liefert auch einige Hinweise, wie man der Entstehung von Depressionen vorbeugen kann. Ein Faktor war der offene Umgang mit der eigenen Homosexualität. Befragte, die bei „allen“ oder „fast allen“ Freunden und Bekannten geoutet waren, berichteten seltener von depressiven Symptomen. Günstig wirkt offenbar auch ein stabiles Sex- und Beziehungsleben: Von den Männern, die laut Angabe in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung keinen Sex hatten, berichtete ein höherer Anteil von depressiven Symptomen (46 Prozent) als von denjenigen, die in diesen Zeitraum einen oder mehrere Sexpartner hatten (29 und 26 Prozent). Bei Befragten, die in einer festen Beziehung leben, war der Anteil derer ohne depressive Symptome deutlich höher als bei Singles (76 zu 58 Prozent).
Den stärksten positiven Einfluss auf das seelische Wohlbefinden der Befragten hatte die soziale Unterstützung. Das entspricht auch allen vorliegenden medizinisch-psychologischen Erkenntnissen. Mit der Anzahl der unterstützenden Personen sank der Anteil derjenigen, die von häufigen depressiven Symptomen berichteten – und zwar von 74 Prozent („niemand“) auf 21 Prozent („10 und mehr Personen“).
Den stärksten positiven Einfluss hat soziale Unterstützung
Das Fazit der Studienleiter: „Gesellschaftliche Homonegativität hat offensichtlich massive Auswirkungen auf die Gesundheit schwuler und bisexueller Männer. Erfahrene Stigmatisierungen begünstigen die Internalisierung von Homonegativität und so die Anfälligkeit für seelische Probleme.“ Diese leisteten nicht nur unkontrolliertem Drogengebrauch Vorschub, sondern verhinderten auch eine erfolgreiche Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. „Viele Männer sind so sehr mit ihren psychischen Belastungen beschäftigt, dass sie gar nicht in der Lage sind, die bestehenden Gesundheitsangebote zu nutzen“, fasst Dirk Sander das Problem zusammen. „Sie haben keinen Nerv dazu – im wahrsten Sinn des Wortes.“
Interview mit Dr. Dirk Sander
Im folgenden Interview erläutert Dirk Sander, DAH-Fachreferent für schwule Männer, die Ergebnisse der Pilotstudie sowie den engen Zusammenhang zwischen seelischer Gesundheit und erfolgreicher HIV-Prävention.
Herr Dr. Sander, schwule und bisexuelle Männer leiden sehr viel häufiger an Depressionen als heterosexuelle Männer. Woran liegt das?
Das schwule Coming-out hört ja nicht an dem Tag auf, an dem man’s Mutti gesagt hat. Sich gegenüber anderen Personen, gegenüber der Gesellschaft mit dem eigenen Schwulsein auseinanderzusetzen, das ist ein lebenslanger Prozess. Dieser wird von einigen Männern als Stress erlebt und kann – neben vielen anderen Faktoren – langfristig zu einer depressiven Erkrankung führen.
Irgendwann ist der Topf dann voll, und der Körper sagt: „Mir reicht’s!“
Wie entsteht dieser „schwule Stress“?
Die Grunderfahrung ist die Auseinandersetzung mit der Homosexualität, die in allen Gesellschaften zumindest auf Vorbehalte stößt, oft sogar auf blanken Hass. Dazu kommen auch traumatische Erfahrungen, zum Beispiel mit Mobbing in der Schule oder im Job, im schlimmsten Fall sogar Gewalt. Diese Belastungen addieren sich im Laufe eines Lebens und formen die Persönlichkeit. Irgendwann ist der Topf dann voll, und der Körper sagt: „Mir reicht’s!“ Dann entsteht eine Depression.
Schwule neigen auch eher zum Konsum von Alkohol und Drogen. Ist das eine Folge dieser Stress-Erfahrungen – oder vielleicht auch eine Ursache von Depressionen?
Darauf gibt es keine einfache Antwort, weil hier zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Bei Alkohol und Drogen geht es zum Beispiel um die Frage, warum man sie nimmt: Will man damit vorhandene Freuden noch steigern? Oder dienen sie dazu, negative Erfahrungen auszublenden? Letzteres könnte eine sehr problematische Strategie zur Stressbewältigung sein und die Entwicklung einer Depression begünstigen.
Aber in Deutschland ist die Situation für Schwule doch rosig. Das Verfassungsgericht hat eben erst die volle Gleichstellung verlangt.

Die politische und rechtliche Situation schwuler Männer hat sich verbessert, das ist richtig. Aber offensichtlich kommen solche strukturellen Maßnahmen nicht oder kaum bei den Individuen an. Der Einzelne ist immer noch starken Stressoren ausgesetzt. Nur ein Beispiel: Die Ausgrenzung homosexueller Jugendlicher an Schulen bleibt die gleiche, auch wenn für Erwachsene die Ehe geöffnet wird. Ähnliches gilt für individuelle Gewalterfahrungen. Diese werden seit Ende der 80er-Jahre in den Studien von Michael Bochow abgefragt. Daher wissen wir: Der Anteil der Männer, die von antihomosexuellen Gewalterfahrungen berichten, hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre nicht wesentlich verändert. Das zeigt auch die jüngste Bochow-Studie von 2013.
Klingt ausweglos.
Diese Tatsache ist ja nicht zwangsläufig. Aber wir müssen uns mit Ausgrenzung und Mobbing beschäftigen. Viele Kinder und Jugendliche lernen schon in der Schule, sich zurückzuziehen. Das sind Strategien der Stressbewältigung, die sie dann ein Leben lang anwenden werden. Die Sozialwissenschaft spricht hier von „Coping-Mechanismen“, von denen es problematische und empfehlenswerte gibt.
Hilfreich: mit anderen Ausgegrenzten eine Community bilden
In der Schule gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit anderen Ausgegrenzten zusammenzutun und eine „Community“ zu bilden. Für eine Broschüre zum Coming-out habe ich hierzu schwule Jugendliche befragt, und die haben damit sehr gute Erfahrungen gesammelt. Zur HIV-Prävention setzt die Deutsche AIDS-Hilfe deshalb auch auf Maßnahmen zur Community-Bildung, zur Selbstwertstärkung. Anders gesagt: Wir wollen die Männer dazu ermutigen, ihr Schwulsein als ein positives Identitätskonstrukt zu verinnerlichen.
Depressionen torpedieren laut Ihrer Studie auch die Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen.
Das wissen wir von unseren Vor-Ort-Arbeitern. Die gehen in die Schwulenszene und verteilen zum Beispiel vor Lokalen Kondome und Safer-Sex-Informationen. Dabei bekommen sie dann hin und wieder von den Gästen die Rückmeldung: „Ach, lasst mich in Ruhe. Ich habe ganz andere Probleme.“
Diese Aussage muss man ernst nehmen: Seit der großen EMIS-Studie wissen wir mit Sicherheit, dass mentale Probleme wie depressive Verstimmungen dafür sorgen, dass schwule Männer Gesundheitsangebote nicht wahrnehmen. Sie sind so sehr mit ihren psychischen Belastungen beschäftigt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich mit Schutzbotschaften auseinanderzusetzen oder zum Beispiel HIV-Test-Angebote zu nutzen. Sie haben keinen Nerv dazu – im wahrsten Sinn des Wortes.
Je mehr Freunde jemand hat, desto weniger anfällig ist er für Depressionen
Was hilft denn gegen Depressionen?
Unsere Pilotstudie zeigt deutlich: der Freundeskreis ist wichtig! Je mehr Freunde oder unterstützende Verwandte die Befragten hatten, desto weniger anfällig waren sie für Depressionen. Ein stabiles soziales Umfeld ist eine gute Impfung gegen psychische Krankheiten.
Freunde haben – das ist leichter gesagt als getan. Wie könnte man denn die Betroffenen dabei unterstützen, Freunde zu finden?
Eine Möglichkeit für Aidshilfen und andere Präventionsprojekte sind zum Beispiel Ausgehgruppen. Sie bieten Neuankömmlingen einen leichten Einstieg in die Schwulenszenen. Und ganz generell bemühen wir uns, diese Szenen zu unterstützen, um einen Schutzraum zu schaffen. Es ist wichtig, dass Menschen einen Ort haben, wo sie so sein können, wie sie sind, wo sie sich nicht verstellen müssen.
Sie sprechen in Ihrer Studie von einem paradoxen Effekt: Einerseits haben schwule Männer, die offen mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen, seltener Depressionen. Andererseits berichten genau diese Männer häufiger von homonegativen Anfeindungen. Fördert ein Coming-out am Ende Depressionen?
Je offener ein schwuler Mann lebt, umso angreifbarer macht er sich. Ob die möglichen Anfeindungen ihn depressiv machen, hängt aber von vielen Faktoren ab, unter anderem von seinen Unterstützungsressourcen. Ist man isoliert, ist eine Anfeindung natürlich problematischer, als wenn man einen stabilen Freundeskreis hat, der einen dann auffängt. Je offener man ist, desto größer ist allerdings auch das Risiko, Diskriminierungen zu erfahren.