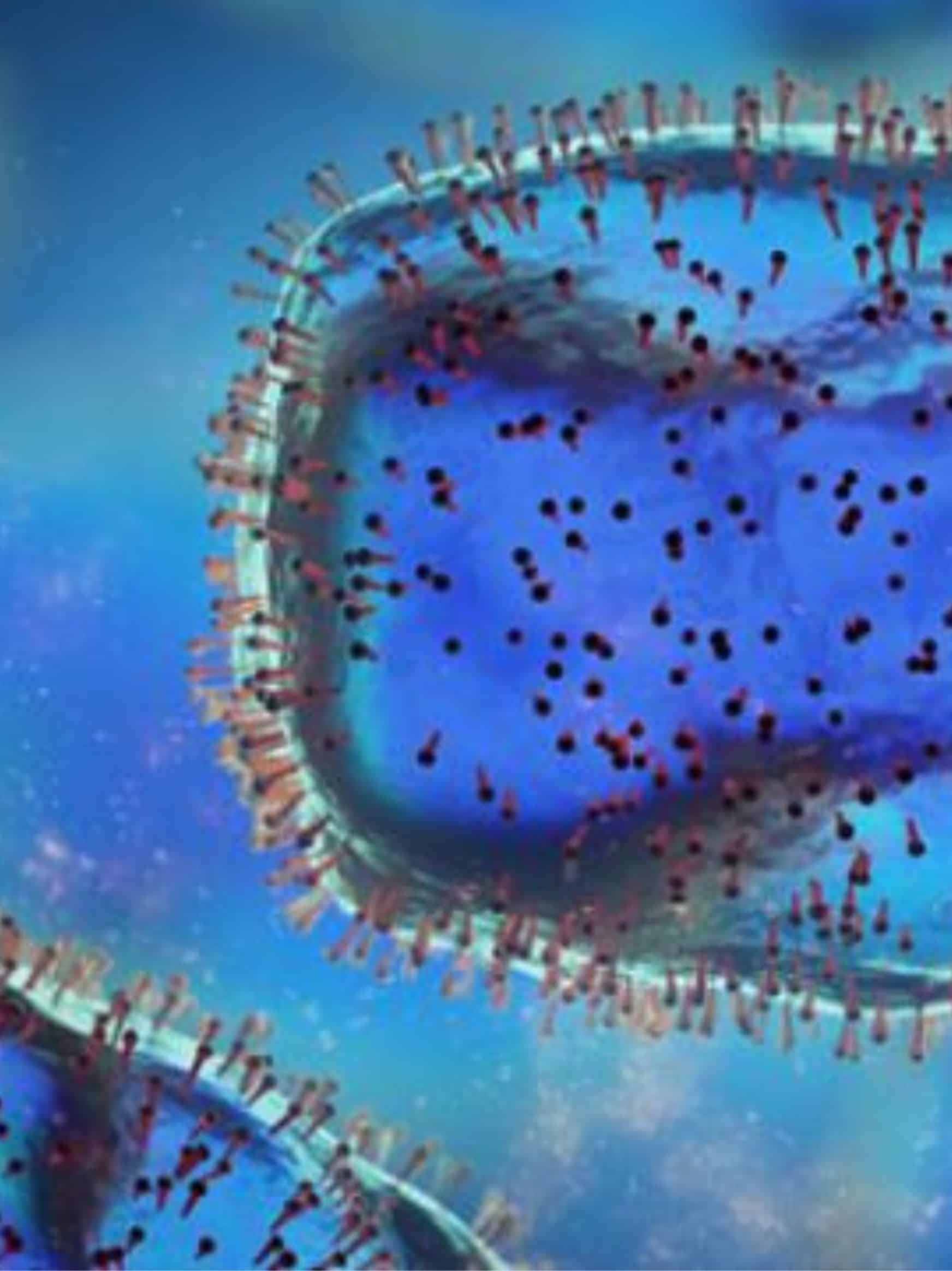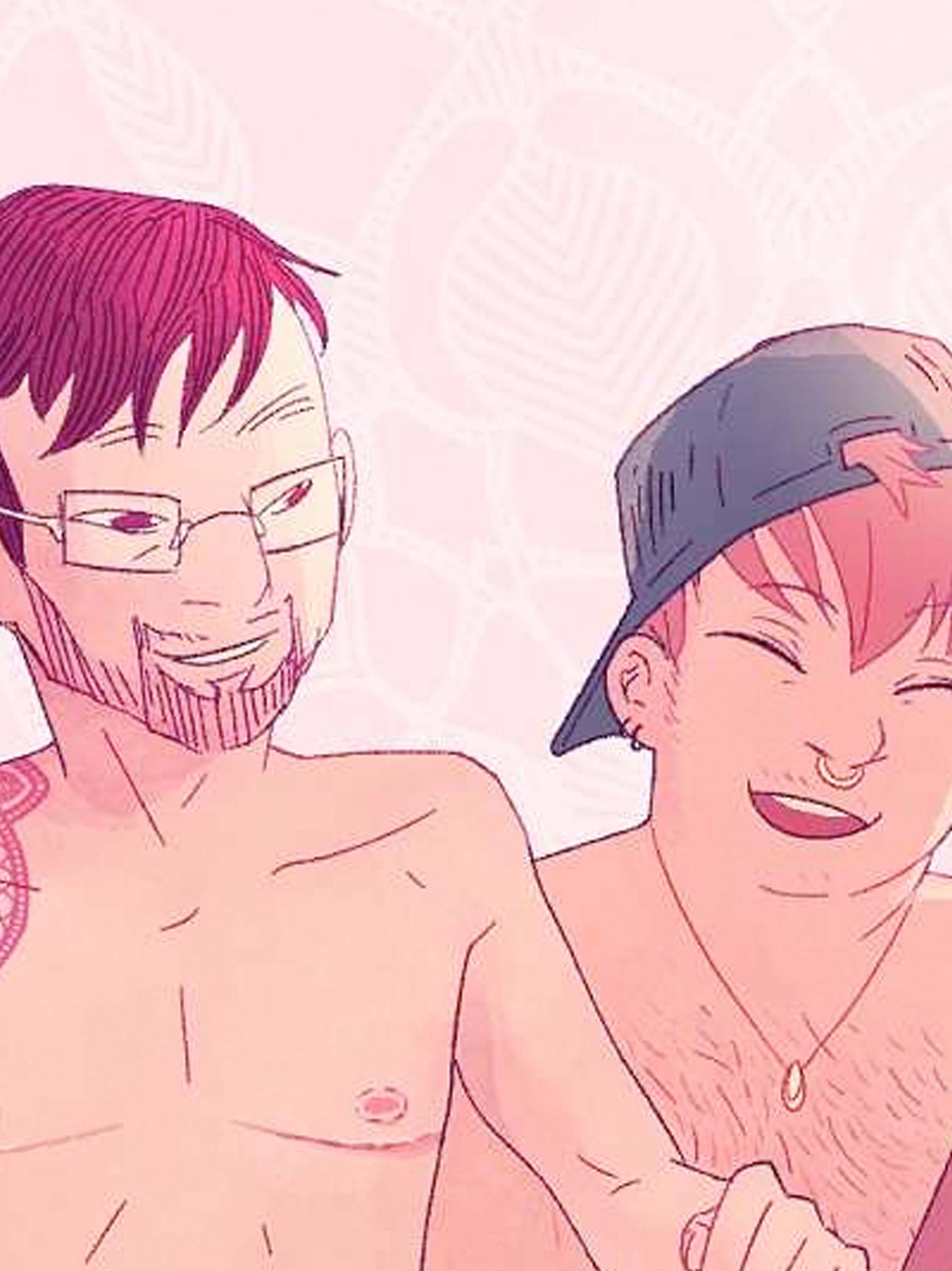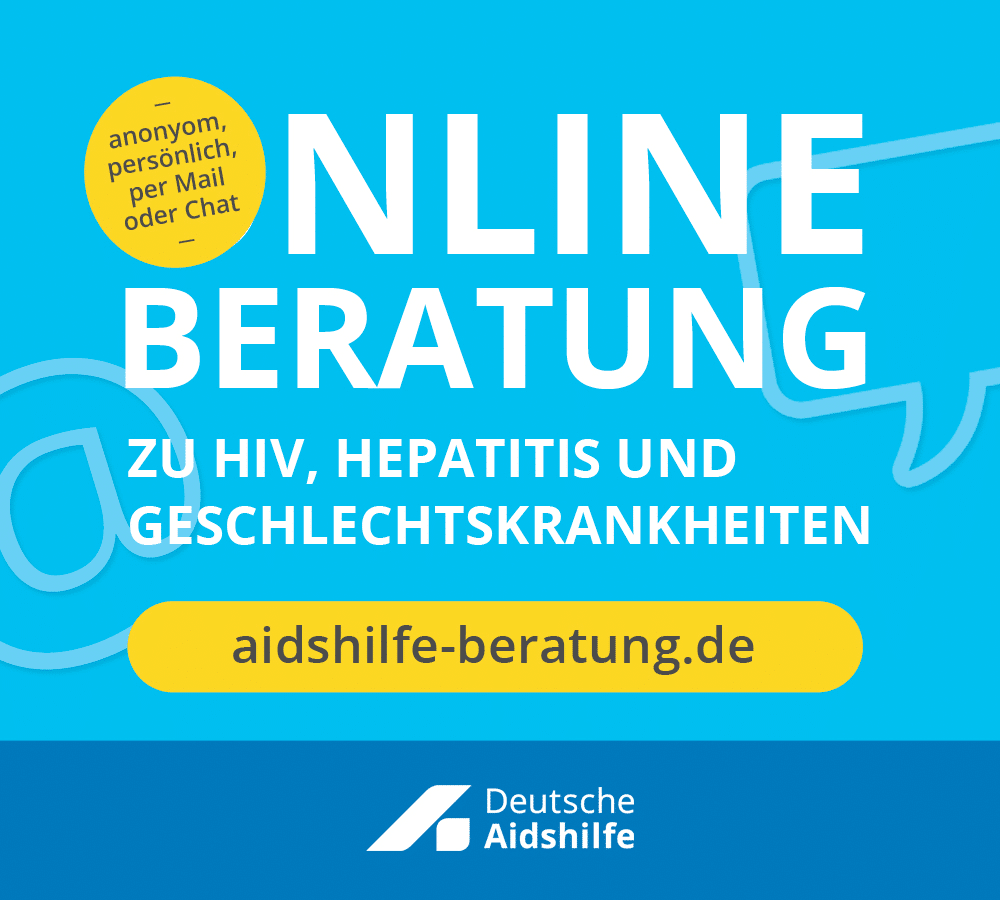Oliver Parkers „Das Bildnis des Dorian Gray“, das ab heute in den Kinos zu sehen ist, kann man sich sparen. Da gibt es längst bessere und vor allem modernere Adaptionen des Oscar-Wilde-Klassikers. Manche drehen sich um das Thema HIV.

Heldenverehrung ist ja für Außenstehende meistens vor allem eins: extrem langweilig. Das gilt auch für Oliver Parkers „Dorian Gray“. Der Regisseur weiß in seiner dritten Oscar-Wilde-Adaption in zehn Jahren wenig mit dem Stoff anzufangen. Er bildet lediglich die Oberflächlichkeiten ab – die Wilde in seinem einzigen Roman nur Mittel zum Zweck der Satire waren.
Und zwar einer bösen: Da beutet ein Jüngling Menschen für seine Zwecke aus, schreckt nicht einmal vor Mord zurück und steigt so in den Londoner Salons der vorletzten Jahrhundertwende zum sagenumwobenen Dandy auf. Im Keller altert derweil an seiner statt ein Gemälde des jungen Mannes.
Der Wunsch nach ewiger Jugend und Unverletzbarkeit trotz eines rein hedonistischen Lebensentwurfs – was hätte das 2010 für einen Stoff abgeben können! Gier statt Menschlichkeit, Sex und eben kein Tod, modische Schönheit statt Persönlichkeit: Gray ist eine leere, von jeder Moral befreite, aber hübsche Hülle, die von den gesellschaftlichen Winden seiner Zeit bis in die höchsten Höhen getragen wird. Wie heutig, wenn man sich denn traut.
Stattdessen verharrt Parker in plüschigem Wohlbefinden, inszeniert leichten Horror vom Blatt und hat sich in Ben Barnes einen Dorian Gray gesucht, der auf so glatte Art schön ist, dass man ihn in Berliner oder Londoner Clubs keines zweiten Blickes würdigen würde.
Da hilft Colin Firth dann auch nicht mehr viel. Als Grays Ziehvater Lord Henry Wotton darf er ein paar hübsche schauspielerische Petitessen abliefern und – während er Gray malt – im wahrsten Sinne des Wortes Farbe auf seine Leinwand ejakulieren.
Wie interessant man den Stoff umsetzen kann, hat Regie-Debütant Duncan Roy vor erst drei Jahren mit seiner Version von „The Picture of Dorian Gray“ bewiesen. Darin versucht Milchgesicht David Gallagher, den man als unschuldigen Jungchristen in „Eine himmlische Familie“ kennt, als Oscar Wilde im New York der 1980er einer geheimnisvollen Krankheit davonzulaufen. Er bleibt jung, schön und gesund, während seine Liebhaber reihenweise sterben, nachdem sie mit ihm geschlafen haben.
Die Modernisierung ist nicht durchgängig gelungen, aber allemal spannender als Parkers Gothic-Kostümschinken. Roys Film lief in Deutschland bislang leider nur auf einigen schwulen Festivals, ist in der Originalfassung aber auf DVD erhältlich.
Wem das zu anstrengend ist, der kann sich die ultimative Gray-HIV-Variation als Roman zu Gemüte führen: Will Selfs 2007er Satire „Dorian“ platziert Wildes Helden in das London der 1990er. Er ist wunderschön schwul, zutiefst oberflächlich, sex- und drogensüchtig, HIV-positiv und ein guter Freund von Lady Di. Selfs mehrfach ausgezeichneter und von der Kritik hoch gelobter Roman ist drastisches, ehrliches, genaues Kopfkino und besser als jeder Spielfilm zum Thema. Und die Taschenbuchausgabe ist zudem billiger als ein schlechter Kinoabend für zwei. (Paul Schulz)
Trailer von „Das Bildnis des Dorian Gray“ (Regie: Oliver Parker)
„The Picture of Dorian Gray“, USA 2007, Regie: Duncan Roy, auf DVD erhältlich (Trailer)
Will Self: „Dorian“, Berliner Taschenbuch Verlag, 352 Seiten, 10, 90 Euro