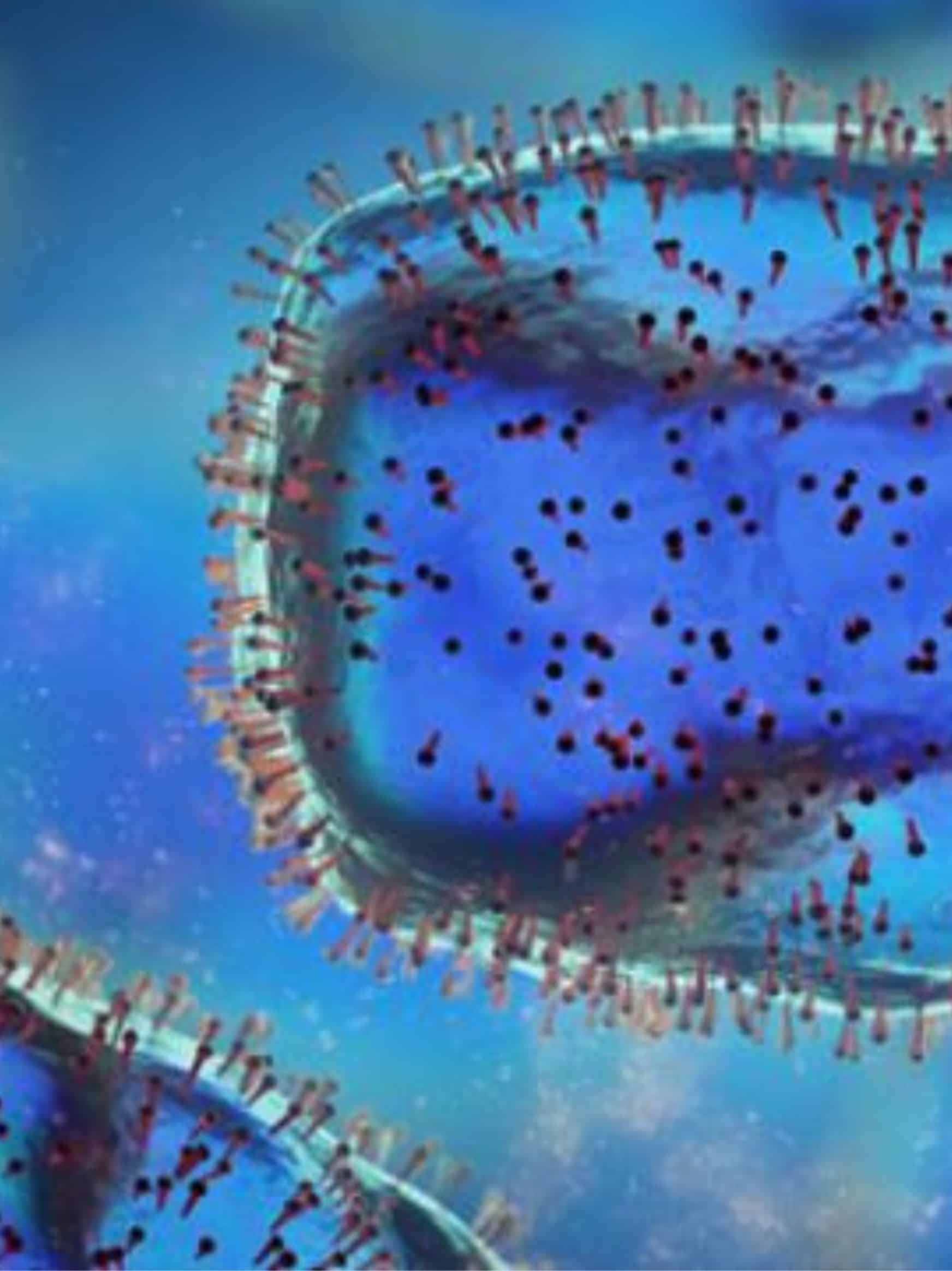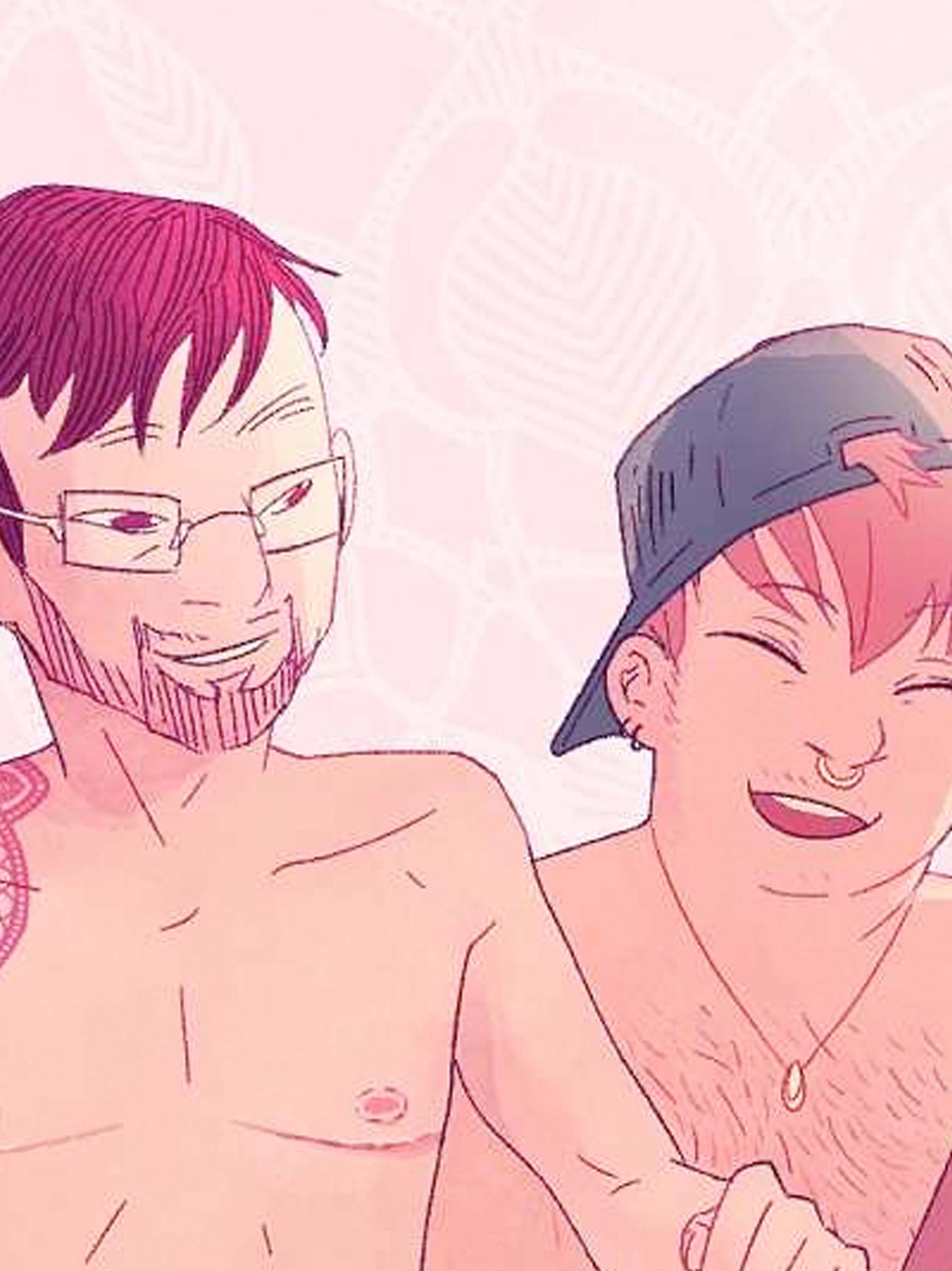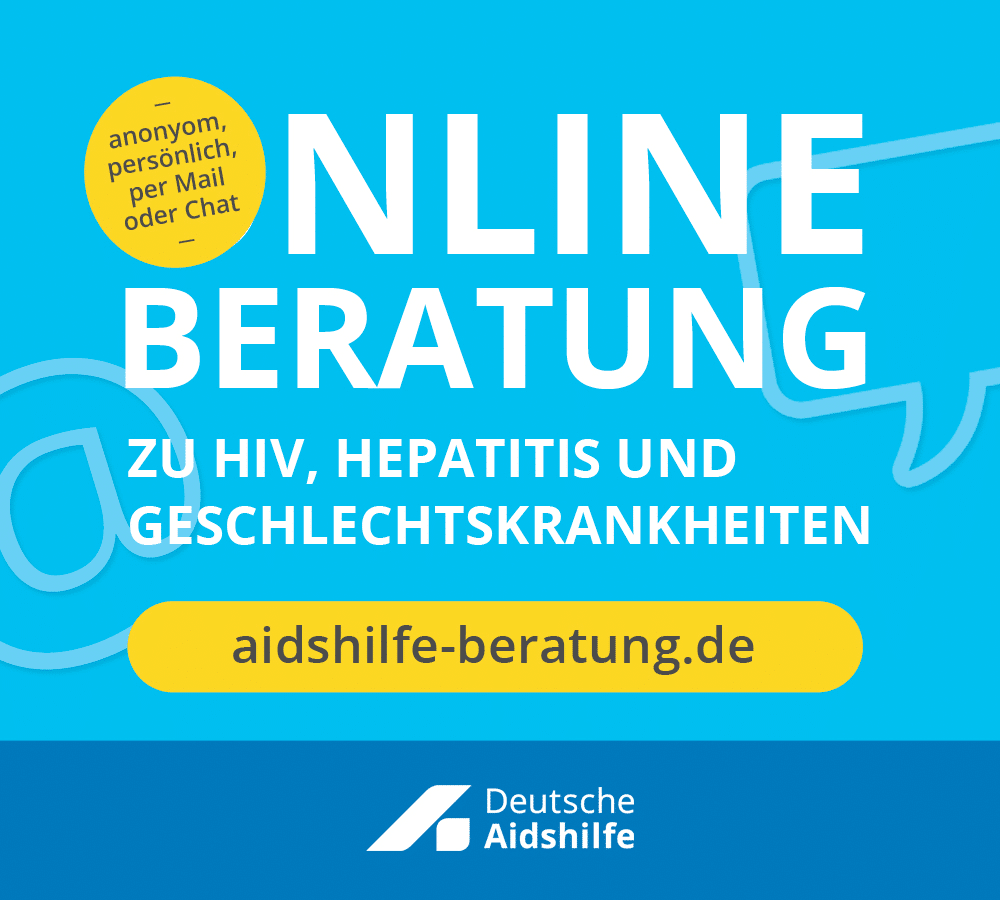Als HIV-Pfleger berät man tagtäglich Menschen mit HIV und kennt die ganzen Infos aus den Hochglanzbroschüren auswendig. Aber was passiert, wenn sich so ein Profi selbst mit HIV infiziert? Was bedeutet das für seine Glaubwürdigkeit und die Entscheidungen, die er in seinem Job trifft? Vor diesen Fragen stand Loek Elsenburg, HIV-Pfleger am VU University Medical Center (VUmc) und am Jan van Gooyen Medical Centre. Von Wiggert van der Zeijden für das HIV-Magazin hello gorgeous.

Loek Elsenburg hat einen fantastischen Job, sagt er, und das steht ihm auch ins Gesicht geschrieben. 2005 dagegen arbeitete er noch im Management des Vumc. „Das war nicht der richtige Platz für mich. Das war eine dieser Positionen am Grünen Tisch, wo man Entscheidungen fällt, deren Auswirkungen auf die Leute man nie wirklich zu sehen bekommt.“ Damals sprach Loek zufällig mit einem der HIV-Pfleger des Krankenhauses und erwähnte, dass er in Rotterdam auch mal als HIV-Buddy tätig war. Der Pfleger erzählte ihm, dass viele Positive in die Klinik kämen, und da machte es Klick bei Loek – einer jener Augenblicke, in denen plötzlich alles klar wird. Loek wurde gefragte, ob er eine Zeit lang eine der Beratungsschichten übernehmen wolle, und kurze Zeit später war er selbst HIV-Pfleger auf einer Vollzeitstelle. Den Job macht er jetzt seit acht Jahren, und seit drei Jahren bietet er auch HIV-Schnelltests am Jan van Goyen Medical Centre in Amsterdam an. Außerdem ist Loek im Vorstand der Niederländischen HIV-Vereinigung (HVN).
„In meinem Beruf hat man nicht für alles eine Lösung, aber man kann helfen, eine gewisse Ordnung ins Chaos zu bringen. In diesem Sinne biete ich vertrauliche Beratung für meine Klienten an. Ich gehe auf ihre Bedürfnisse ein, spiegele, was sie denken, und teile ihre Emotionen auf konstruktive Weise.“
Eine Frage müssen sich Menschen mit HIV immer wieder stellen: Soll ich „es“ anderen sagen oder lieber für mich behalten? Zu Hause, bei der Arbeit oder in der Schule darüber zu sprechen, das wird oft als großes Tabu gesehen. „Viele meiner Klienten leben mit einem großen Geheimnis“, sagt Loek. „Sie trauen sich nicht, den Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld zu sagen, dass sie HIV-positiv sind. Insbesondere heterosexuelle Männer mit HIV fühlen sich in der Folge dann oft einsam. Schwule Männer dagegen reden untereinander tendenziell offener darüber, vielleicht auch, weil sie meistens schon das Coming-out hinter sich haben. Schwule sind auch besser informiert. Heterosexuelle Männer wollen das Beratungsgespräch am liebsten so kurz wie möglich halten. Sie sind froh, wenn es vorbei ist und sie nach Hause gehen können.“
Auch im Jan van Goyen Medical Centre hat Loek viel mit heterosexuellen Männern und Frauen zu tun. Er führt dort HIV-Schnelltests durch, deren Ergebnisse schon nach etwa 20 Minuten vorliegen. „Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko können auch im örtlichen Gesundheitsamt einen Schnelltest machen, alle anderen werden normalerweise an ihren Hausarzt verwiesen. Manche Heteros und Heteras kommen aber lieber zu uns, weil sie sich hier anonymer und geschützter fühlen. Das zeigt, wie groß das Stigma rund um HIV immer noch ist.“
Loek hat bei seiner Arbeit schon einiges erlebt. Es ist immer schwer, jemandem ein positives HIV-Testergebnis mitteilen zu müssen, aber viel schwerer sind die Folgen, wenn sich jemand nicht behandeln lässt. „Für eine kleine Minderheit der Patienten ist es so schwer, ihren HIV-Status zu akzeptieren, dass sie einfach alle Infos abblocken, ihre Tabletten nicht regelmäßig einnehmen oder sogar die Behandlung ganz ablehnen. Ich habe Leute sterben sehen, die leicht hätten überleben können. Das passiert selbst heute noch.“

Vor ein paar Jahren verschlechterte sich auch Loeks eigene Gesundheit. Er hatte mehrere Termine bei seinem Hausarzt, war dort aber nicht immer völlig offen, wie er zugibt. Und so sprachen sie zwar über seine Beschwerden und die möglichen Ursachen, aber ohne diese eine, bestimmte anzusprechen. „Ich kenne das von meinen Patienten und erlebe das auch bei meinen Kontakten in der Szene: die Fähigkeit, etwas nicht an sich heranzulassen, die Tendenz, den Kopf in den Sand zu stecken, um nicht zuzugeben, dass du Risiken eingegangen bist, obwohl du das genau weißt.“ Schließlich sprach einer von Loeks Kollegen ihn an, ob er nicht selbst mal einen Test machen sollte. „Das hat mich unglaublich hart getroffen“, sagt Loek, „aber es war natürlich genau das, was ich brauchte.“
Das Ergebnis war eindeutig: Loek war HIV-positiv. „Ich habe mich so geschämt“, sagt er. „Dass ich als Profi es nicht geschafft hatte, das zu verhindern. Weil ich, ein HIV-Pfleger, mich infiziert hatte, fühlte ich mich als Versager. Dabei hatte ich so häufig mit Freunden darüber diskutiert, wie wichtig es ist, seine eigenen Fehler zu akzeptieren. Und natürlich ist Schuld auch tief in allen Religionen verankert, die unsere Identitäten mitformen. Letzten Endes lief es auf die Frage hinaus, ob ich mir selbst vergeben kann. Heute bin ich mir sehr bewusst, dass das Leben nicht immer nach Plan verläuft.“
Plötzlich stand Loek also selbst vor der Frage: Soll ich es anderen erzählen oder lieber für mich behalten? Er hatte schnell mit der Therapie angefangen, sein Gesundheitszustand hatte sich rasant verbessert und er machte wieder HIV-Beratungen. Dennoch war etwas anders, und das hatte viel mit seinen Patienten zu tun. „In gewisser Hinsicht war alles wie vorher, aber ich fühlte mich immer unwohler dabei, wenn mir die Patienten ihre innersten Gedanken und Sorgen anvertrauten. Ja, ich fühlte mich als Heuchler. Ich bestand darauf, dass sie ehrlich zu mir waren, aber ich selbst verschwieg ihnen etwas sehr Wichtiges.“
„Natürlich geht es in einem medizinischen Kontext überhaupt nicht an, mit den Patienten über die eigene Situation zu sprechen. Das ist eine sehr hierarchische Welt, in der es als Zeichen von Professionalität gilt, Beruf und Privatleben sauber zu trennen. Das nennen sie ‚die professionelle Distanz‘. Und es gibt ja tatsächlich auch Risiken. Man will ja nicht, dass Patienten, die sehr manipulativ sein können, diese Information missbrauchen. Und natürlich will man auch nicht, dass eine Beratungssitzung plötzlich zu so etwas wie einer Selbsthilfegruppe wird. Trotzdem hatte ich immer stärker das Bedürfnis, offen mit meinem eigenen Status umzugehen, und ich habe darüber auch mit meinen Kollegen und anderen Beschäftigten gesprochen.“
Schlussendlich führte das zu einer Veränderung, die ihn auf lange Sicht zufriedener hat werden lassen. „Ich habe die Entscheidung getroffen, nach und nach, wann immer es passend und angemessen erschien, meinen Patienten auch von mir zu erzählen, und sie haben das wirklich sehr gut und warmherzig aufgenommen. Und das Ganze hatte noch einen weiteren positiven Effekt: Meine Patienten wurden plötzlich zu Diskussionspartnern, und wir begegneten uns auf Augenhöhe. Wer hierherkommt, ist oft sozusagen mit seinem Latein am Ende. Und ich kann ihnen dann von meinen eigenen Ängsten und Zweifeln erzählen, aber auch von den Entscheidungen, die ich getroffen habe, und die sich alle als gut herausgestellt haben. Und wenn ich erzähle, dass auch ich meinem Hausarzt nicht alles erzählen konnte und wie ich mich geschämt habe, dann scheinen sie sich leichter öffnen zu können.“
Heute spricht Loek auch in Workshops und Coachings über seine Erfahrungen, zum Beispiel bei der HIV-Vereinigung oder bei ACTA, der Amsterdamer Zahnärzte-Akademie. Neulich fragte ein Student ihn, ob er den Klienten Safer Sex beibringen muss. „Bei dieser Frage habe ich mich sehr unwohl gefühlt“, sagt Loek. „Das hat gesessen. Aber ich habe im Leben so einige Lektionen gelernt. Zum Beispiel über die Kraft und den Nutzen der Akzeptanz, über das Aufgeben von Vorurteilen und vorgefertigten Meinungen. Damit muss jeder Patient sich auseinandersetzen, und ich bin froh, dass ich meine Erfahrungen mit ihnen teilen kann.“
Herzlichen Dank an Herausgeber Leo Schenk, an Wiggert van der Zeijeden und an Henri Blommers für die Erlaubnis zur Veröffentlichung
(Fotos: Henri Blommers; Übersetzung der englischen Version: Holger Sweers.)