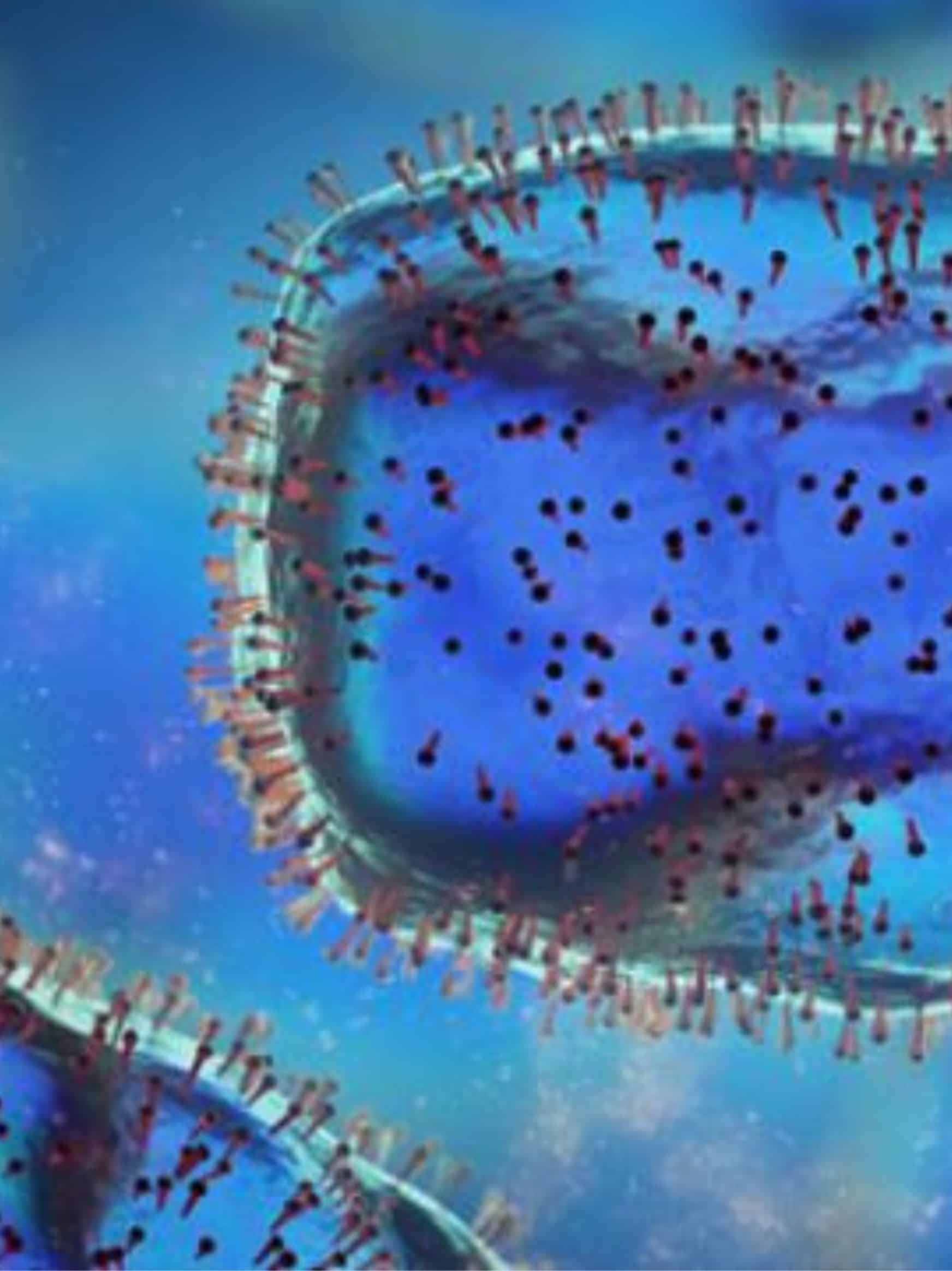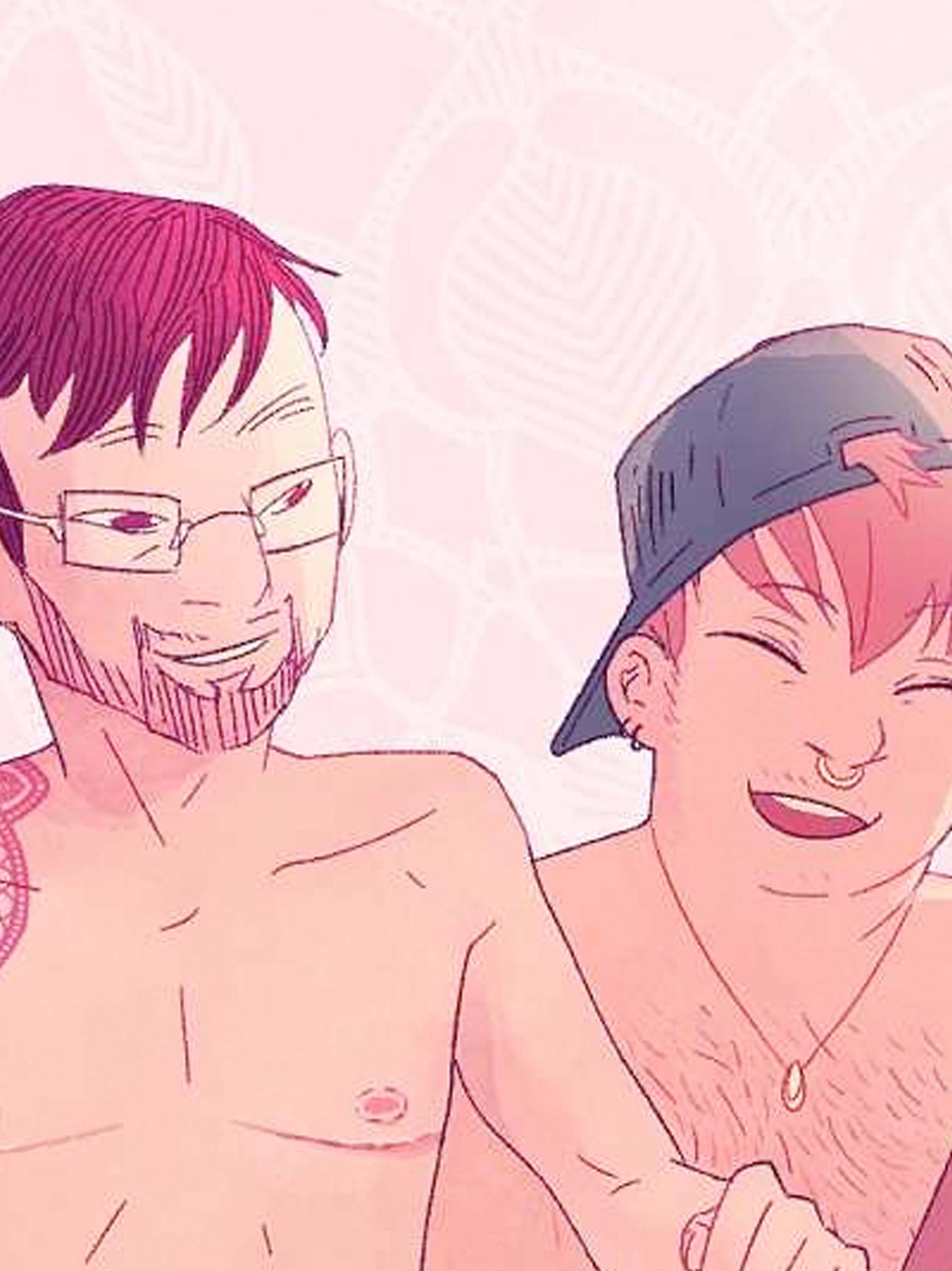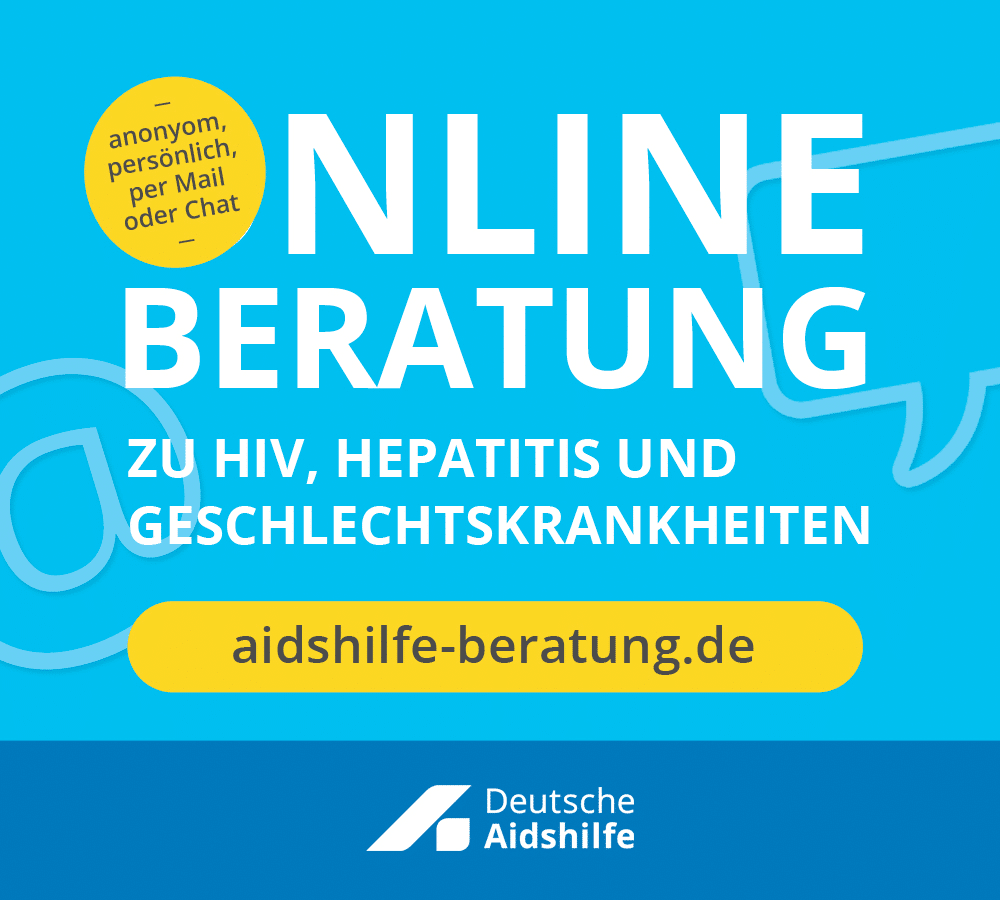Carsten Stock spielt für sein Leben gern Fußball. Angefangen hat er als Kind auf einem Bolzplatz in Rinteln, als Student in Hannover hat er sogar einen Verein mitgegründet: Mit dem FC Union Hannover spielte Stock einige Jahre in der Amateurliga, in einem anderen Verein war er Jugendtrainer. Auch als Berufstätiger ist Carsten Stock seinem Lieblingssport treu geblieben: Seit 2002 ist er Mitglied im schwul-lesbischen Sportverein Startschuss Hamburg, 2004 übernahm er die Leitung der Fußball-Abteilung – alles ehrenamtlich. Dabei lässt ihm sein Beruf nur wenig Freizeit: Der 43-Jährige ist kaufmännischer Leiter einer großen Autohausgruppe in Hamburg. 2012 würdigte der Deutsche Fußballbund (DFB) dieses Engagement mit dem DFB-Ehrenamtspreis. Auf iwwit.de erzählt Carsten Stock, warum er sich für seinen Verein stark macht – und wie ihm Sport beim Coming-out geholfen hat.
Carsten, du hast schon mit Heten und Homos Fußball gespielt. Gibt es da einen Unterschied, wenn dein Team fast nur aus Schwulen besteht?
Ja, klar. Du gehst offener miteinander um. Jeder weiß vom andern, dass er schwul ist. Das ist ganz selbstverständlich. Ein anderer großer Unterschied ist natürlich, dass unser Startschuss-Team eine Freizeitmannschaft ist. Das heißt, wir nehmen an Turnieren teil, müssen aber nicht jedes Wochenende auf dem Platz stehen. Aber auch bei den Wettkämpfen herrscht eine besondere Atmosphäre: Sie ist lockerer, wie in einer großen Familie. Man freut sich, die Leute wiederzusehen, bei schwulen Turnieren entstehen viele Freundschaften. All das hast du beim normalen Punktspielbetrieb in der Form nicht.
Wie bist du auf dein jetziges Team bei Startschuss aufmerksam geworden?
Übers Internet. 2001 habe ich Startschuss angeschrieben – und dann drei Monate keine Antwort bekommen. Ich habe bestimmt schon seit 2000 überlegt, mal bei Startschuss vorbeizuschauen. Aber ich habe mich sehr schwer getan damals, ich steckte mitten im Coming-out. Auf der Startschuss-Website stand was von Cheerleadern. Wenn du vorher nur in der Hetero-Welt Fußball gespielt hast und gerade in deiner Coming-out-Phase steckst, dann fällt es dir verdammt schwer, dir männliche Cheerleader vorzustellen. Alleine die Vorstellung hat damals gereicht, um mich abzuschrecken.
Es gibt ein tolles Werbefoto von den Startschuss-Fußballern: Die Abwehrmauer springt – und alle tragen eine Damenhandtasche. Hattet ihr keine Angst, dass dieses tuntige Bild Interessenten abschrecken könnte, die noch im Coming-out stecken? So wie bei dir damals?
Das ist schon was anderes. (lacht) Wir tragen ja keine Röckchen, sondern nur Handtaschen. Es gibt ein berühmtes Vorbild: eine Fotomontage mit der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft, die eine Mauer bildet. Irgendjemand hatte den Spielern Handtaschen in die Hände montiert. Wir haben das in echt nachgestellt. Alle unser Werbepostkarten, die wir für den Hamburger CSD gestaltet haben, gehen ja in eine ähnliche Richtung: Wir nehmen uns nicht so ganz ernst. Es macht viel Spaß zu sehen, wie die Leute auf so ein Motiv reagieren. Du gehst über den CSD, drückst den Leuten die Postkarte in die Hand und zauberst ein Lächeln in die Gesichter. Das ist genial! Genau das wollen wir erreichen: Wir spielen mit dem Klischee, dass alle Leute tuntig sind – und die Leute müssen lachen. Sie haben einen positiven Bezug und setzen sich mit dem ganzen Thema auseinander. Beim CSD erreichst du ja viele Heten. Und die sehen bei der Gelegenheit, dass Schwule ganz anders sind, als sie immer gedacht haben.
Ist es Teil deines Ehrenamtes, Klischees zu brechen?
Da sind zwei Ziele: Einerseits wollen wir die Heten erreichen und Klischees widerlegen. Auf der anderen Seite machen wir Werbung für Startschuss. Die Fußballer waren einige Zeit die einzige Startschuss-Abteilung, die beim Hamburger CSD mitgelaufen ist. Einfach weil wir Nachwuchssorgen hatten. Bei der Analyse haben wir uns gefragt: Wissen schwule Fußballer überhaupt, dass es in Hamburg auch einen schwul-lesbischen Sportverein gibt? Und wir mussten feststellen: Die meisten wissen nichts davon. Startschuss ist der größte schwul-lesbische Verein der Stadt, aber in der Öffentlichkeit war er kaum präsent. Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück geändert – auch dank unserer CSD-Aktionen.
Wie viel Zeit kostet dich die Vereinsarbeit?
Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es sehr viel zu tun. Zum Beispiel wenn ein internationales Turnier anliegt wie die IGLFA EURO 2013 im Juni in Dublin. Die finanzielle Abwicklung und anderes lief über mich. Außerdem mussten wir Treffen organisieren, um die Leute überhaupt zum Mitkommen zu motivieren. Da steckst du schon viel Zeit rein: Du musst drauf achten, dass alle bezahlen. Du musst Trikots bestellen und nach Dublin schaffen. Du musst die Betten verteilen, und, und, und … Es gibt viel zu tun. In den Anfangsjahren musste ich vieles alleine stemmen, aber inzwischen habe ich zwei Stellvertreter, es gibt zwei Trainer. Die Aufgaben sind nun auf mehrere Schultern verteilt. Das ist zu schaffen.
Warum opferst du so viel von deiner Freizeit für den Verein? Du musst nebenher ja auch noch einen Vollzeit-Job stemmen.
Ich denke, das ist einem in die Wiege gelegt. Ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Und das bedeutet: Du lernst Verantwortung. Das andere ist: Wenn ich was tue, dann möchte ich es mitgestalten. Und das kannst du nur, wenn du Verantwortung übernimmst. Ich bin kein Mitläufer.

Wenn du zurückblickst: War es eine gute Entscheidung, in einen schwulen Sportverein zu gehen?
Ja, es gab zwei wichtige Katalysatoren bei meinem Coming-out: Das war zum einen der Fußball bei Startschuss und zum anderen das Segeln. Über das Portal Eurogay habe ich damals eine Gruppe von acht Leuten kennengelernt, in der wir dann Segeln waren: Abends sitzt du dann an Deck beim Bier zusammen und unterhältst dich in Ruhe, ähnlich wie bei Fußballturnieren. Du erfährst viel über das Leben und die Wege anderer Menschen. Das war für mich sehr wichtig. Auf dem Schiff erzählte einer mal, dass er es verpasst hat, seinen Eltern zu erzählen, dass er schwul ist. Inzwischen seien sie zu alt, dass er es ihnen nicht mehr zumuten könne. Für mich war dieses Gespräch der Anlass, mich bei meinen Eltern zu outen. Nicht weil ich das Gefühl hatte, dass sie dann glücklicher sind – sondern weil wir dadurch offener miteinander sein können. Bis dahin hatte ich einen wesentlichen Teil meines Lebens vor meinen Eltern ausgeblendet.
Inzwischen hast du für dein Engagement sogar den DFB-Ehrenamtspreis bekommen. Die Vorbehalte schwinden, auch im Fußball. Wird dein Verein bald überflüssig, weil schwule Fußballer voll akzeptiert in Hetero-Teams kicken können?
Nein, das glaube ich nicht. Ein schwuler Verein bietet eine besondere Atmosphäre. Du hast einen Raum der Freiheit, den du anderswo nicht hast. Für mich war es genau der richtige Ort für mein Coming-out und um für mich einen Weg zu finden, als Schwuler zu leben. Von dieser Bedeutung hat der Verein nichts verloren. Deshalb bin ich überzeugt, dass es Startschuss noch viele Jahre geben wird.
Eine recht aktuelle Zusammenstellung schwul-lesbischer Sportvereine in ganz Deutschland gibt es auf der Website des Berliner Vereins Vorspiel Berlin.