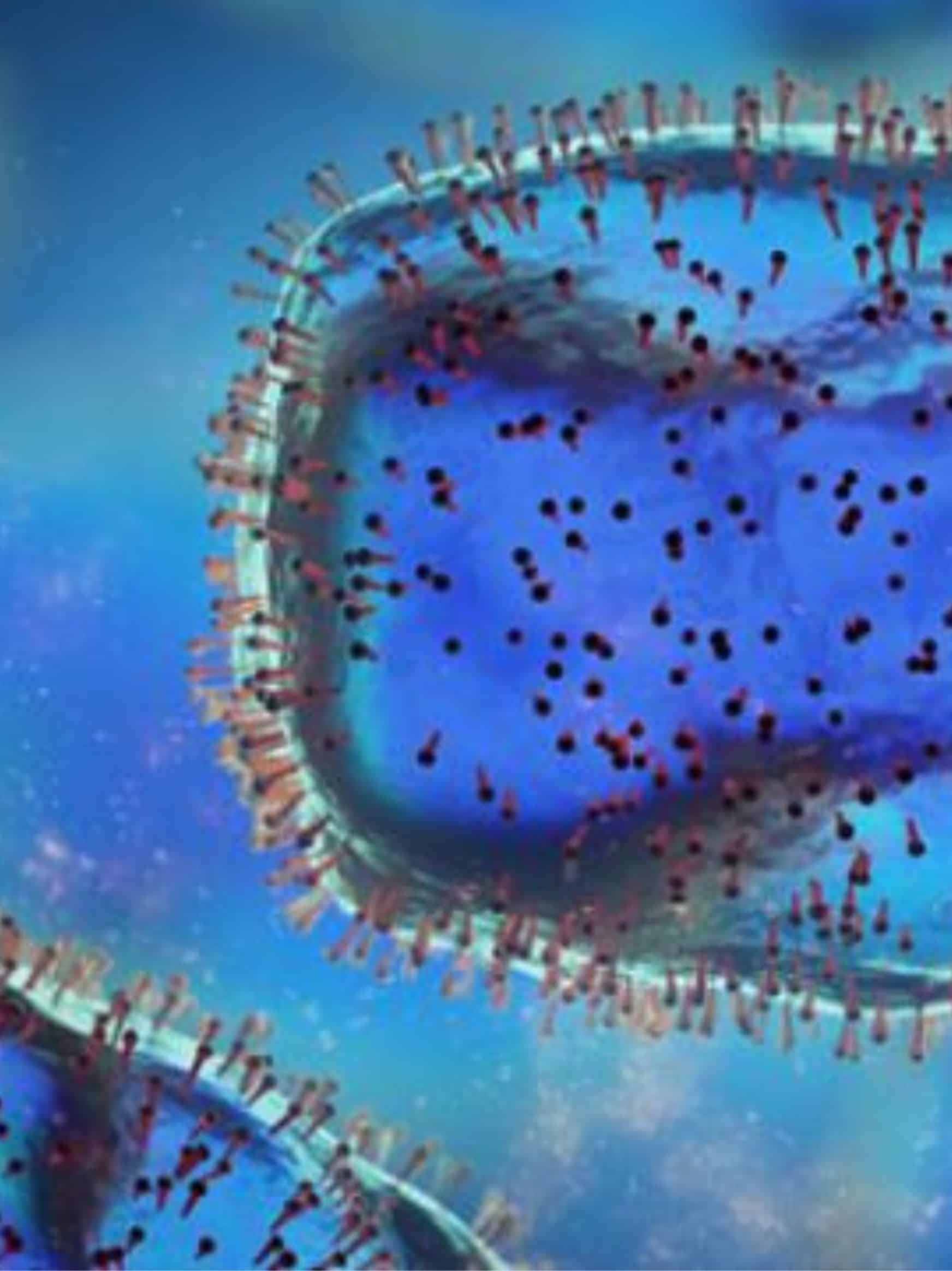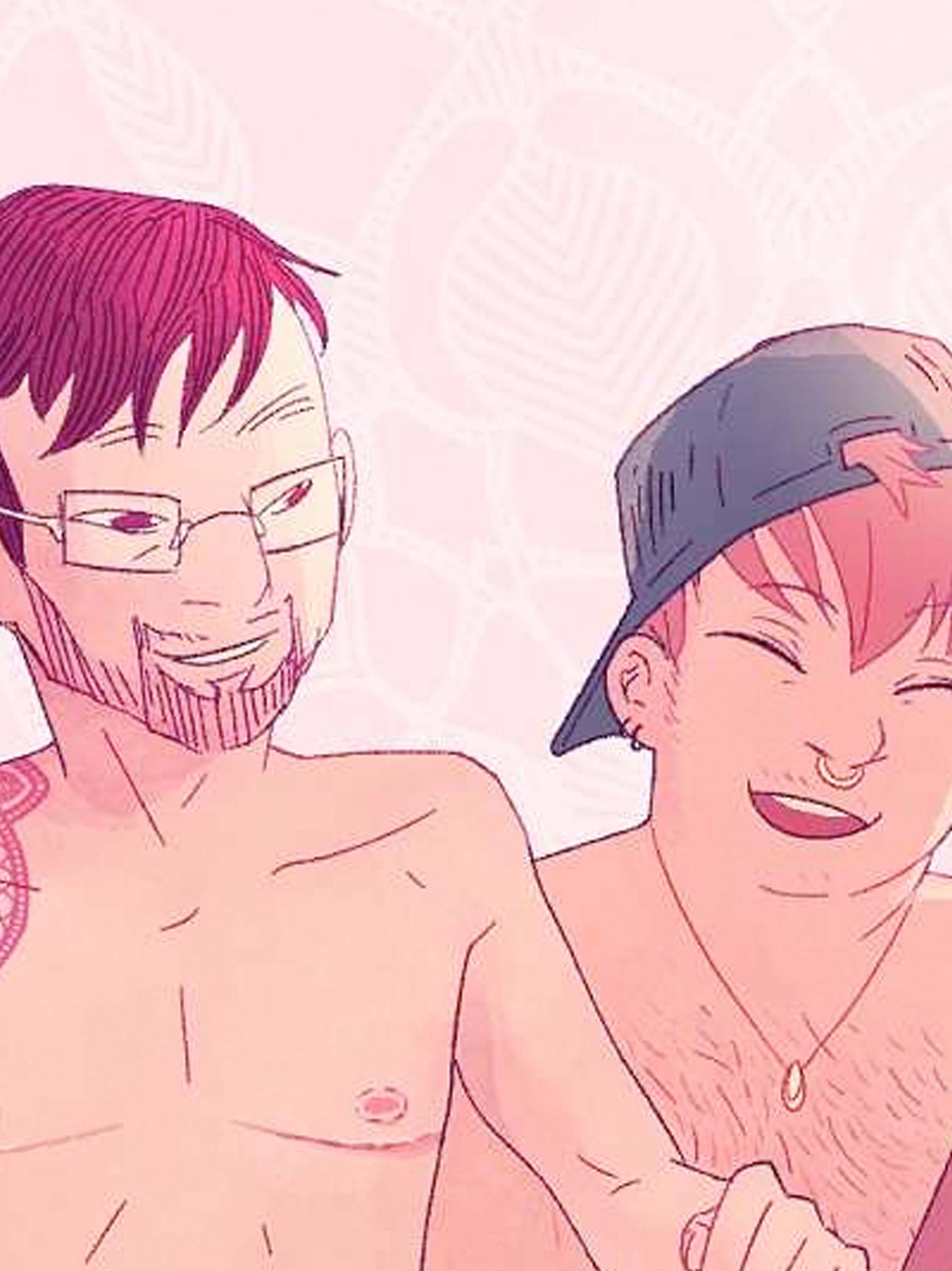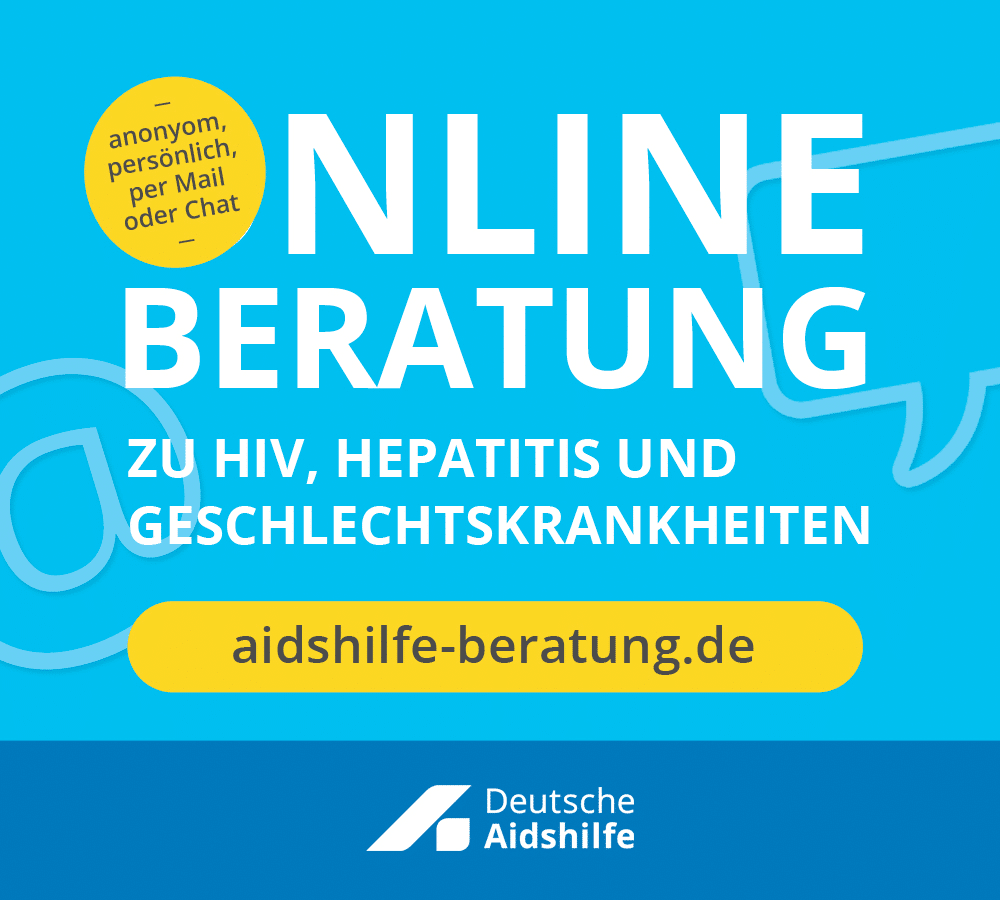Trotz allem: Irrationale Ängste vor HIV sind auch in der Community weit verbreitet.
Jochen Drewes (Foto) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin im Bereich Public Health/ Gesundheitswissenschaften. Schwerpunkt seiner Arbeit sind die psychosozialen Aspekte von HIV/AIDS, Prävention und sexuelle Gesundheit. Das Projekt positive stimmen wird von ihm wissenschaftlich begleitet. Carmen Vallero sprach mit ihm über seine Arbeit, über die Veränderungen von Stigmatisierung über die Zeit und wie sich Stigmatisierung auch in den Communities selbst zeigt.
Jochen, Du beschäftigst dich seit einigen Jahren mit der Lebenssituation von Menschen mit HIV und Aids. Die Infektion hat sich gewandelt und ist heute für viele Positive zu einer behandelbaren, chronischen Erkrankung geworden, mit der es sich (fast) wie jede/r andere/r auch leben lässt. Wie hat sich der Alltag von HIV-Positiven dadurch geändert?
„Tatsächlich hat sich durch die wirksamen heute verfügbaren Medikamente, die auch immer seltener zu schweren Nebenwirkungen führen, HIV zu einer chronischen Erkrankungen gewandelt, mit der die meisten Betroffenen gut leben können. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer Diabetes-Erkrankung, bei der ebenfalls eine regelmäßige Einnahme von Medikamenten und eine regelmäßige Kontrolle des Gesundheitszustands durch den Arzt erforderlich ist.
Allerdings stellt das Management der eigenen Erkrankung auch hohe Anforderungen an die Betroffenen. Und beiden Erkrankungen ist sicher auch gemein, dass eine gewisse Unsicherheit und Angst immer ein Begleiter bleibt. Im Fall von HIV ist das z.B.: Was passiert, wenn die Medikamente versagen? Welche Langzeitnebenwirkungen werden die Medikamente haben? Habe ich ein erhöhtes Risiko für Krebs und andere Krankheiten?
Aber bei aller Gemeinsamkeit gibt es doch auch fundamentale Unterschiede zwischen HIV und Diabetes. Der wahrscheinlich Bedeutendste besteht in der gesellschaftlichen Reaktion auf die Erkrankung und die davon Betroffenen: die HIV-Infektion ist eine stark stigmatisierte Erkrankung. Und Menschen mit HIV erfahren deshalb auch heute noch Ablehnung und Zurückweisung, Verurteilung und Schuldzuweisungen.“
Hat sich mit der Veränderung der Krankheit auch die Stigmatisierung und Diskriminierung der Menschen mit HIV gewandelt?
„Mit dem medizinischen Fortschritt bei der Behandlung der HIV-Infektion hat sich auch die Sichtbarkeit von HIV geändert. Ein besonders gutes Beispiel dafür ist der Rückgang der Lipodystrophie. Diese Veränderungen des Fettstoffwechsels, vermutlich durch einige Medikamente verursacht, führten zu den bekannten Bildern von ausgemergelten Gesichtern. Heute sind weniger HIV-Infizierte davon betroffen und für die meisten ist es damit viel einfacher geworden, die Infektion zu verschweigen.
Wir erleben seit geraumer Zeit eine ‚Privatisierung’ von HIV, die Infektion spielt sich für viele Positive ‚im Privaten’ ab. Und obwohl die Normalisierung natürlich ihre guten Seiten hat, ist mit der Privatisierung von HIV auch eine große Gefahr des Rückzugs, der Isolation verbunden. Ich vermute, dass dieser normalisierte Umgang mit einem Anstieg des internalisierten Stigmas, mehr eigener Scham und Schuldgefühlen verbunden ist.
Allerdings wissen wir wenig über das Ausmaß und das Wesen von internalisiertem Stigma unter HIV-Positiven. Ich setze da große Hoffnungen auf das Projekt positive stimmen, bei dem ja zum ersten Mal in Deutschland alle Aspekte von Stigmatisierung in einer großen deutschlandweiten Stichprobe erhoben werden.“
In Deutschland ist die von HIV am stärksten betroffene Gruppe Männer, die Sex mit Männern haben. Stigmatisierung zeigt sich aber auch in dieser Community. Im Jahr 2010 wurden im Rahmen der Evaluation der Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) 10.000 Männer, die Sex mit Männern haben und HIV-negativ getestet oder ungetestet sind, zu ihrer Meinung über HIV-Positive befragt. Du hast die Daten ausgewertet. Welches Ergebnis hat Dich am meisten überrascht?
„Stigma in der schwulen Community ist bis heute kaum untersucht worden. Bisherige Studien haben sich immer auf die Allgemeinbevölkerung konzentriert, wahrscheinlich weil sie implizit davon ausgingen, dass in den Gruppen, die überdurchschnittlich stark von HIV betroffen sind, Stigmatisierung kein Thema ist. Wir können nun zeigen, was nicht wirklich verwunderlich ist: Auch schwule und bisexuelle Männer stigmatisieren HIV-Positive.
Am meisten hat mich die weite Verbreitung irrationaler Ängste vor einer HIV-Übertragung durch den Kontakt mit HIV-Positiven gerade bei schwulen und bisexuellen Männern erstaunt. Jeder fünfte Teilnehmer an der Befragung würde einen HIV-Positiven nicht auf den Mund küssen, weitere 20 % sind sich da unsicher. Ich bin überzeugt, dass diese Männer wissen, dass sie sich durch Küssen nicht mit HIV infizieren können. Zum anderen verbinden auch viele der Befragten eine HIV-Infektion mit Scham und Schuldzuweisungen. So war jeder dritte Teilnehmer an der Befragung überzeugt, dass er sich schämen würde, wenn er sich mit HIV infizieren würde. Schuld und Scham, das sind dann auch genau die Gefühle, mit denen viele Positive kämpfen.“
Im Jahr 2008 sorgte die EKAF-Veröffentlichung für Aufregung: HIV-infizierte Menschen ohne andere sexuell übertragbare Krankheiten sind unter wirksamer antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös. Für viele Menschen mit HIV bedeutete dies eine unheimliche Erleichterung. Die Erkenntnisse wurden breit diskutiert und kürzlich noch einmal durch eine Studie wissenschaftlich belegt. Trotzdem kommst Du bei der Auswertung der IWWIT-Kampagne zu dem Schluss, dass die sexuelle Ablehnung von HIV-positiven MSM hoch ist. Woran liegt das?
„Tatsächlich ist der auffälligste Befund unserer Untersuchungen die starke sexuelle Ablehnung von Menschen mit HIV, obwohl Safer Sex ja einen sicheren Schutz vor einer HIV-Übertragung bietet. Die Befunde, dass die Infektiösität von Positiven durch die antiretrovirale Therapie stark gesenkt wird, und manche Wissenschaftler bereits sagen, dass eine sexuelle Übertragung des Virus in diesem Fall nicht mehr möglich ist, sind tatsächlich ein Grund für eine Erleichterung für Positive. Auch wenn man die umstrittene Umsetzung dieser Befunde in Präventionsbotschaften mal außen vor lässt, so erwarten doch viele, dass mit der geringeren Ansteckungsgefahr auch eine geringere Ablehnung, Zurückweisung und Stigmatisierung einhergeht.
Inwiefern diese Hoffnungen begründet sind, ist derzeit noch unklar. Wir sehen auf der einen Seite, dass Ängste vor HIV sehr irrational und hartnäckig sein können. Zum anderen haben sich die Erkenntnisse noch nicht sehr weit verbreitet, da sie auch kaum offiziell kommuniziert werden. Die Repräsentationen, die Vorstellungen über HIV, die Übertragungswege und die Gefährlichkeit, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind und die Einstellungen des Einzelnen beeinflussen, ändern sich ebenfalls nur langsam. Da ist noch viel Arbeit nötig.“
Das Interview führte Carmen Vallero.