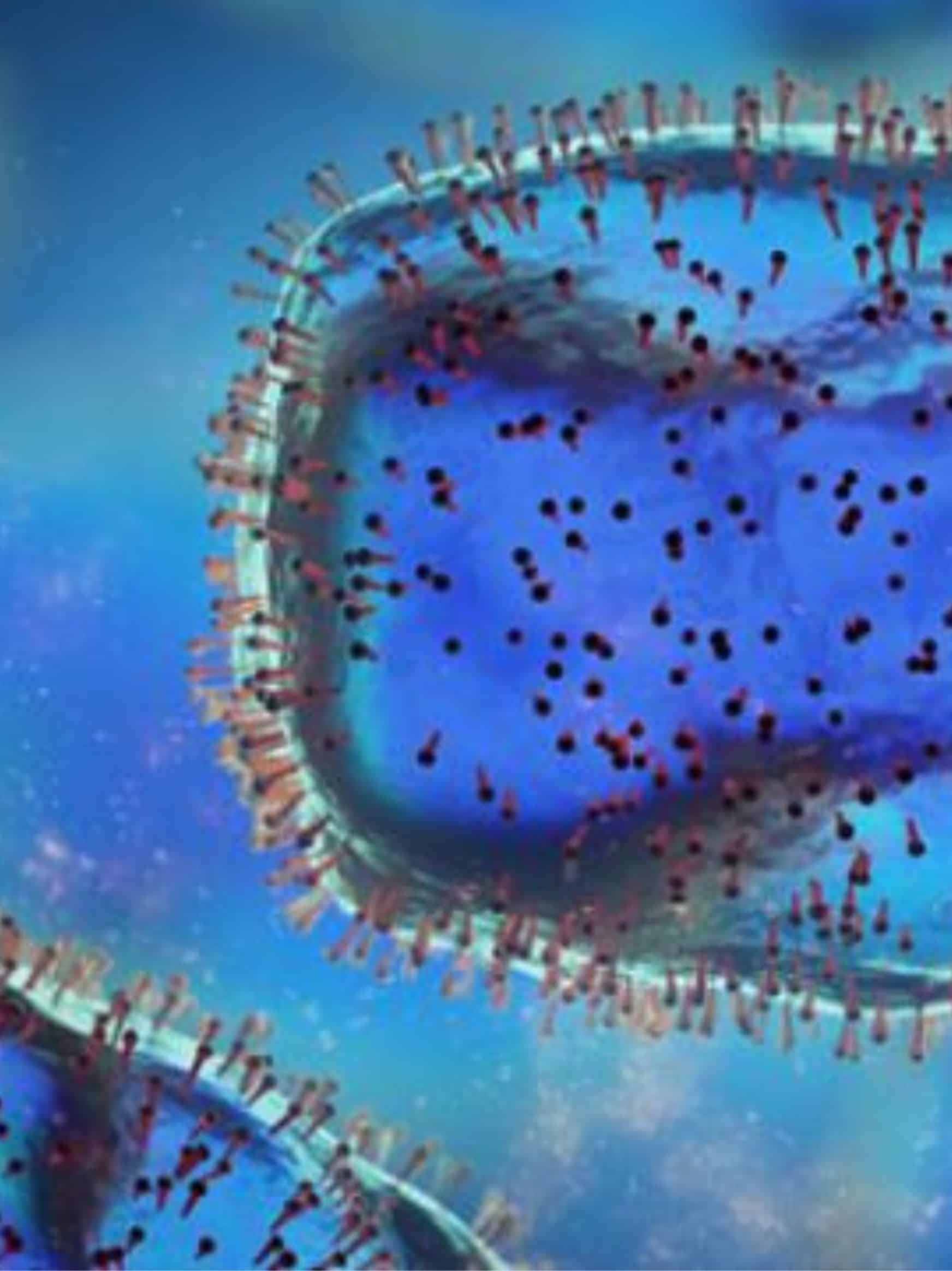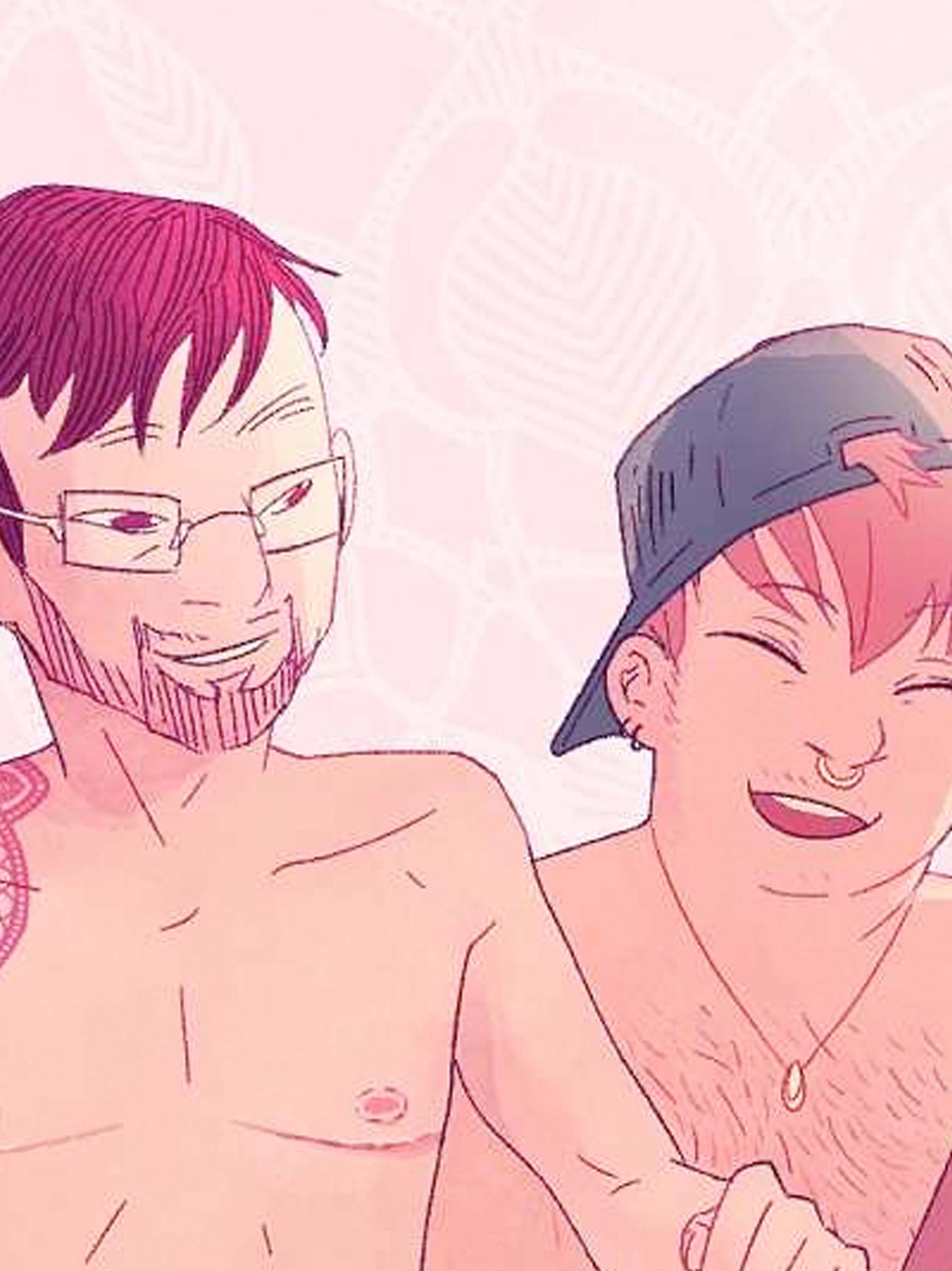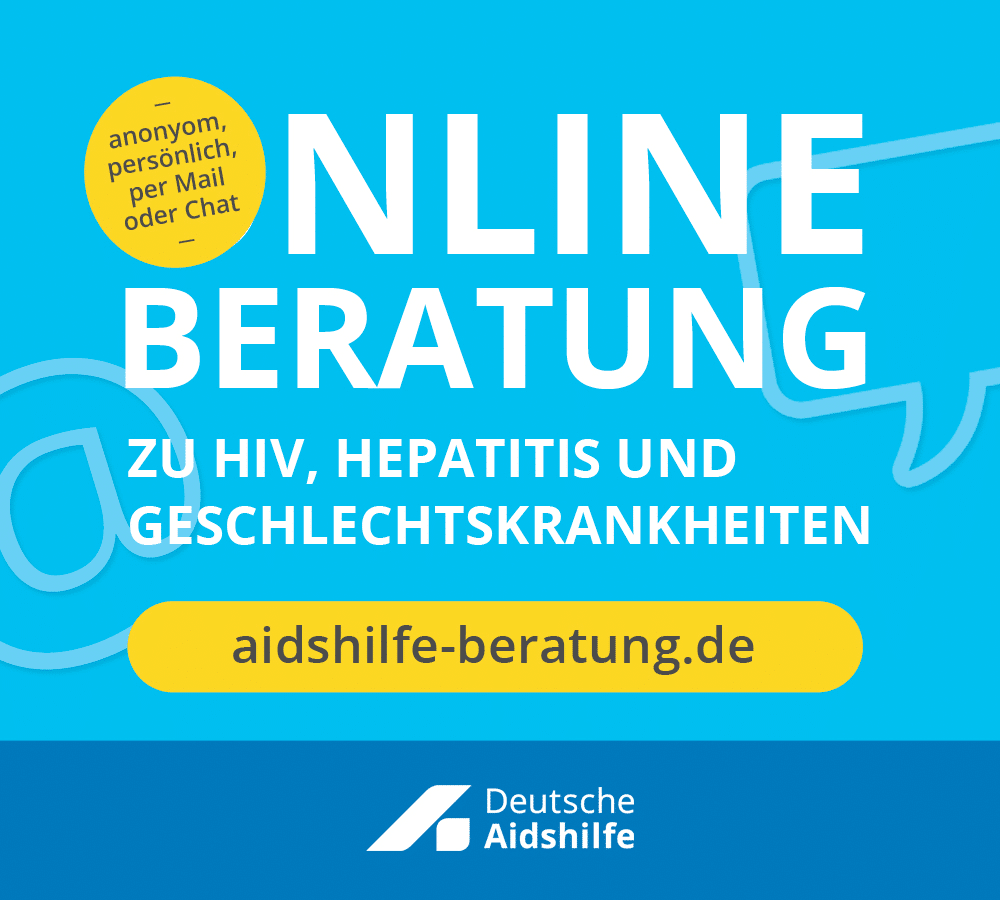Michael Stock dokumentiert in „Postcard to Daddy“, wie ihn sein Vater jahrelang sexuell missbraucht hat. Der Film stellt große Fragen und findet im Familienkreis Antworten. Sogar den Vater hat Michael Stock vor die Kamera bekommen.

„Postcard to Daddy“ hätte Einiges werden können: Anklageschrift, Protestbrief, Lamento. Es ist ein Film über Vergebung geworden, darüber, wie man den Menschen im Monster (wieder)findet und den Versuch unternimmt, ihm zu verzeihen, damit man ihn endlich loslassen kann. Ein behutsamer Exorzismus.
Michael Stock wurde zwischen seinem achten und sechzehnten Lebensjahr von seinem Vater sexuell missbraucht. Weder seine Mutter noch seine beiden Geschwister haben davon gewusst.
Mama hielt die schulischen Probleme und Persönlichkeitsveränderungen ihres jüngsten Kindes für einen normalen Teil der Pubertät, die ältere Schwester und der große Bruder waren längst mit sich selbst beschäftigt und hatten sich angewidert vom Alkoholiker-Vater zurückgezogen. Der hatte so ungehinderten Zugriff auf sein jüngstes Kind.
In „Postcard to Daddy“ erzählt Stock diese Geschichte, macht sich aber vor allem auf die Suche nach Grundlagen, Hintergründen und Folgen seines Leidensweges: Warum hat niemand etwas gemerkt? Wie hat die Ehe der Eltern funktioniert? Warum hält der Bruder noch Kontakt zum Vater, obwohl er weiß, was der Michael angetan hat? Wie erarbeitet sich die Schwester einen normalen körperlichen Umgang mit ihren eigenen Kindern?

Der Film verhandelt die großen Fragen nach Schuld und Sühne direkt mit den Betroffenen. Stock bleibt dabei mit der Kamera eng bei sich und seiner Familie. Mit seiner Mutter reist er in die Berge und nach Thailand, führt dort lange Gespräche. Das Urlaubsvideo will er dann seinem Vater schicken, um mit ihm ins Gespräch zu kommen – daher der Titel „Postcard to Daddy“.
Und tatsächlich: Sogar den Vater hat Michael Stock am Ende vor die Kamera bekommen. Selbst in diesem Gespräch schafft er es, ruhig und sachlich zu bleiben, obwohl der Film insgesamt höchst persönlich und emotional ist.
Das ist seine große Stärke. Eine Fiktionalisierung des Stoffes hätte die Geschichte in Frage gestellt, und der Zuschauer hätte sein Grauen im Schutzraum Kunst parken können. In dieser Dokumentation hingegen ist Flucht nicht möglich. Sie ist aber auch nicht nötig, weil Stock nicht hassen und verurteilen will, sondern begreifbar machen.
Das gilt auch dafür, dass er sich Anfang der 90er Jahre in der wilden Berliner Homoszene mit HIV infiziert hat. Er hatte viel Sex in dieser Zeit und konsumierte jede Menge Drogen. Davon handelte 1993 Stocks erster Spielfilm „Prinz in Hölleland“.

Heute, mit 41, kann Stock glasklar benennen, dass er sich aufgrund seiner Missbrauchserfahrung lange nur als den sehen konnte, der sich sexuell zur Verfügung stellt, damit andere an ihm Spaß haben. Der Schutz seiner Gesundheit war ihm dabei nicht wichtig. „Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich Sex als etwas begreifen konnte, was ich selbst bestimmen kann“, sagt er. So kam zu HIV später noch eine Hepatitis-C-Infektion.
Michael Stock hat „Postcard to Daddy“ seinem ehemaligen Lebensgefährten Rémi gewidmet, der es nicht geschafft hat, die schwierige Beziehung zu seinem Vater aufzuarbeiten: Er nahm sich das Leben. Rémi steht exemplarisch für all die Ungehörten und Unverstandenen, für die Stock mit seinem Film auch spricht.
„Postcard to Daddy“ hat auf der Berlinale in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit erhalten, ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden und wird von Publikum und Kritik genauso gelobt wie von Organisationen, die sich um Opfer oder Täter von Kindesmissbrauch kümmern.
Trotzdem hat die ARD sich gerade bedauernswerterweise dagegen entschieden, den Film auszustrahlen. Im Kino ist „Postcard to Daddy“ seit letztem Donnerstag zu sehen.
„Postcard to Daddy“, von und mit Michael Stock, D 2010, Edition Salzgeber
Homepage des Films